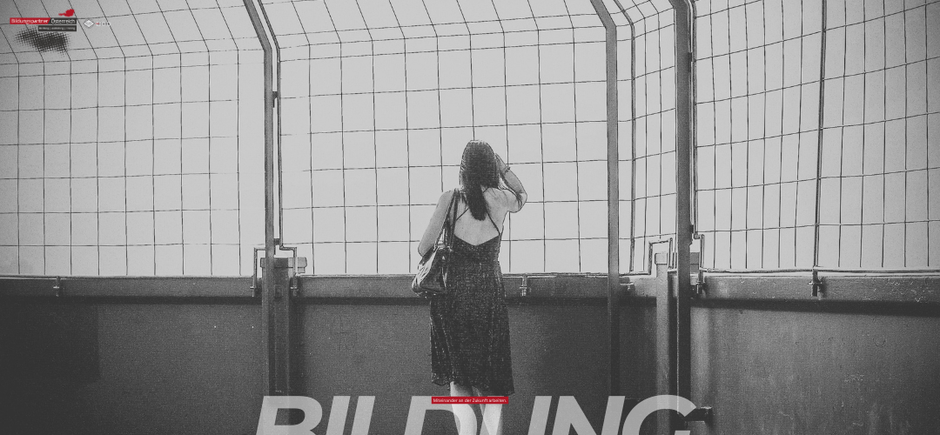
Das Unbekannte
Fremdes Verstehen und Begleiten
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Die Xenagogik entfaltet einen tiefgründigen Zugang zur Begegnung mit dem Fremden. Weit entfernt von reiner Integration, erforscht dieser Zugang die philosophischen Bedingungen eines Umgangs, der das Anderssein achtet und die produktive Spannung zwischen dem Eigenen und dem Unbekannten sowie dem Fremden zum Kernpunkt erhebt.
Begriffliche Herkunft und Bedeutung
Die Xenagogik stellt einen spezialisierten, philosophisch fundierten Ansatz im pädagogischen Diskurs dar. Die begriffliche Wurzel liegt in der altgriechischen Sprache, zusammengesetzt aus xénos für den Fremden bzw. Gast und agōgé für Leitung, Erziehung und Begleitung. Im Kern befasst sich die Xenagogik mit der Lehre vom Umgang mit dem Fremden. Obwohl der Wortstamm "agōgé" direkt auf einen (an-) leitenden Akt verweist, wird die Essenz des Konzepts in der heutigen Rezeption treffender durch den Begriff des "Umgangs" besser noch der "Begleitung" erfasst. Eine solche Umschreibung vermeidet konsequent hierarchische Missverständnisse, die mit dem Wort "Führung" verbunden sein könnten.
Abgrenzung von Integration und kultureller Überformung
Es geht in dieser Denkweise nicht um eine assimilierende Eingliederung oder eine Überformung durch dominante Kulturtechniken. Vielmehr beschreibt der Begriff eine begleitende Haltung, die dem Fremden Raum und Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Logik und Sinnhaftigkeit eröffnet. Die Entwicklung des xenagogischen Denkens ist untrennbar mit dem Werk des Philosophen Franz Fischer sowie Thomas Altfelix (Recherche dazu lohnt sich) verbunden. Fischers komplexes Konzept der "Proflexiven Sprachlogik" bildet dabei das Fundament. Franz Fischers Logik basiert auf der Annahme, dass Sinn nicht in isolierten Begriffen oder Aussagen ruht, sondern sich immer im Spannungsfeld von Gegensätzen konstituiert. Jeder Begriff enthält implizit (s)einen Gegenbegriff. Das Eigene ist ohne das Fremde nicht denkbar und Identität entsteht erst durch Abgrenzung und Bezugnahme zur Alterität (die Phänomene, in denen ein Selbst dem Außen begegnet und es als anderes konstruiert, um sich der eigenen Identität zu vergewissern und sich sicher zu fühlen.
Differenz als produktives Moment
Ein xenagogischer Umgang bedeutet, den Gegensatz zwischen „Eigenem“ und „Fremdem“ nicht zu verdrängen oder aufzulösen, nicht zu harmonisieren, sondern ihn als produktives, sinnstiftendes Moment anzuerkennen. s ist der kognitive Versuch, im Denken, in der Kommunikation und im Austausch eine Bewegung zu vollziehen, die das Gegenüber nicht als passives Objekt erfasst, sondern als aktiv mitgestaltenden Pol der eigenen Welterfahrung begreift. In einem solchen Denksystem wird das Fremde nicht als Problem, Störfaktor oder Defizit wahrgenommen, sondern als notwendiger Gegenpol zum Eigenen, der zur vertieften Selbstreflexion anregt.
Voraussetzungen für eine dialogische Begegnung
Jede Begegnung mit dem Fremden initiiert einen Prozess der Infragestellung eigener Selbstverständlichkeiten und kultureller Gewissheiten. Xenagogik stellt also die grundlegende Frage, wie ein Umgang gestaltet sein muss, damit er nicht in Bevormundung und/oder Vereinnahmung mündet. Sie thematisiert die Voraussetzungen für ein dialogisches miteinander umgehen, in dem das Fremde in seiner Andersartigkeit bestehen bleibt und gerade dadurch eine bereichernde und transformierende Wirkung entfaltet. Thomas Altfelix hat dieses Konzept in die pädagogische Diskussion eingebracht und es als spezifische Antwort auf die Herausforderungen in heterogenen Gesellschaften positioniert. Er betont, dass es um eine Haltung des "Geleitens" geht, die dem und den Fremden Raum zur eigenen Sinnentfaltung lässt und die wechselseitige Beziehung unter Berücksichtigung ihren Eigenarten in den Mittelpunkt stellt.
Abgrenzung zu anderen pädagogischen Ansätzen
Die Abgrenzung zu anderen pädagogischen Konzepten schärft das Profil der Xenagogik. Die interkulturelle Pädagogik bspw. arbeitet an der Verbesserung des Zusammenlebens in kulturell vielfältigen Gesellschaften. Ihre Ziele sind pragmatisch auf die Förderung von Toleranz, den Abbau von Vorurteilen und die Schaffung gemeinsamer Verständigungsgrundlagen ausgerichtet. Sie operiert mit Kulturstandards bzw. Modellen zur Überbrückung kultureller Differenzen. Inklusive Pädagogik wiederum strebt die volle Teilhabe aller Menschen an gesellschaftlichen Prozessen an, unabhängig von ihren individuellen Merkmalen. Hier liegt der Fokus zentral auf der Beseitigung von Barrieren und der Schaffung von Strukturen, die Vielfalt als Normalität begreifen und Diskriminierung abbauen und verhindern.
Die Xenagogik setzt auf einer grundlegenderen, philosophischen Ebene an. Sie hinterfragt die Bedingungen der Möglichkeit einer echten Begegnung. Bevor über Integration oder Inklusion gesprochen wird, analysiert die Xenagogik die Haltung, mit der dem/den Fremden begegnet wird. Der Umgang, von dem hier die Rede ist, ist ein dialogischer, ein vornehmlich zurückhaltender.
Haltung der Begleitenden
Die Begleitendenden sind zugleich Lernende, die durch die Perspektive des Fremden die Grenzen der eigenen Welt erfahren. Es ist eine besondere Form des Austausches und der Interaktion, die auf Machtasymmetrien und Deutungshoheit bewusst verzichtet und stattdessen eine wechselseitige Transformation anstrebt. Aus diesem Blickwinkel stehen das Eigene und das Fremde in einer unauflöslichen, produktiven Spannung. Das Fremde wird zum Spiegel, in dem das Eigene erst seine Konturen gewinnt und sich seiner eigenen Kontingenz bewusst wird. Im Unterschied zum transkulturellen Ansatz, der von einer zunehmenden Verwischung und Hybridisierung von Kulturen ausgeht, beharrt die Xenagogik auf der Existenz von Differenz und Fremdheit als bleibende Realität.
Praktische Relevanz in der Bildungsarbeit
Die praktische Relevanz eines solchen theoriegeleiteten Ansatzes erschließt sich in der Reflexion pädagogischen Handelns. Pädagoginnen und Pädagogen in der Jugend- und Erwachsenenbildung stehen permanent vor der Aufgabe, Lernprozesse in heterogenen Gruppen zu gestalten. Genau dafür bietet die Xenagogik ein wertvolles Korrektiv zu vorschnellen Harmonisierungsbestrebungen und Effizienzdenken. Sie ermutigt dazu, Irritationen, Missverständnisse und das Gefühl des Nichtverstehens nicht als Scheitern des pädagogischen Prozesses, sondern als dessen produktiven Kern zu begreifen.
Xenagogisch geschulte Pädagoginnen und Pädagogen versuchen nicht, kulturelle Differenzen einzuebnen oder Konflikte um jeden Preis zu vermeiden. Sie schaffen stattdessen einen geschützten Rahmen, in dem das Aushalten von Ambiguität und die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten als zentrale Kompetenz erworben werden können.
In der Praxis bedeutet ein xenagogischer Umgang z. B., in einem Sprachkurs für Zugewanderte nicht nur Vokabeln und Grammatik zu vermitteln, sondern auch Raum für die Herkunftssprachen und die mit ihnen verbundenen Weltbilder zu schaffen. Es geht darum, Lernumgebungen zu gestalten, in denen die Logik des Anderen exploriert werden darf, ohne sie sofort zu bewerten oder in bekannte bzw. eigene Schemata einzuordnen. Der xenagogische Umgang ist im Grunde die Kunst des aufmerksamen Fragens, des aktiven Zuhörens und des gemeinsamen Nachdenkens über die Grenzen des Verstehens.
In der politischen Bildung könnte dieser Zu- und Umgang bedeuten, dass kontroverse Standpunkte nicht sofort einem Faktencheck oder einer moralischen Zurückweisung zu unterziehen. Stattdessen zielt der Lernprozess darauf ab, die innere Logik der fremden Argumentation nachzuvollziehen. Teilnehmende erwerben dabei die Kompetenz, die Prämissen und Wertesysteme, die einer anderen Meinung zugrunde liegen, zu rekonstruieren, ohne ihnen zuzustimmen zu müssen. Damit verschiebt sich der Fokus von der Überzeugung zur Analyse des Verstehensprozesses selbst.
Kritikpunkte und Herausforderungen
Trotz der theoretischen Tiefe ist die Xenagogik nicht frei von Kritik. Ein immer wieder eingeworfener Einwand betrifft ihre beschränkte praktische Anwendbarkeit in stark institutionalisierten und standardisierten Bildungssettings, die vorzugsweise auf messbare Ergebnisse und Effizienz ausgerichtet sind. Das darum, weil der Ansatz zeitintensiv ist und eine hohe Reflexionsbereitschaft der Lehrenden erfordert. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Gefahr, gesellschaftliche Machtverhältnisse zu übersehen. D.h., ein rein philosophisch-dialogischer Ansatz läuft Gefahr, die realen Asymmetrien und strukturellen Diskriminierungen zu vernachlässigen, die den Umgang mit Fremdheit in der Gegenwart prägen.
Ohne eine machtkritische Fundierung bleibt der Appell zur Offenheit ein rein individuell-moralischer Anspruch. Aber bei aller Kritik sind die Kernimpulse der Xenagogik in einer globalisierten, von Migrationsbewegungen und digitaler Polarisierung geprägten Welt von hoher Aktualität. Die Kompetenz, Fremdheit nicht als Bedrohung, sondern als Anstoß für die eigene Entwicklung zu sehen, ist aus der Sicht der Pädagogik eine zentrale Ressource für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und vor allen die persönliche Bildung. In jedem Fall liefert die Xenagogik zumindest die philosophische Begründung für eine Pädagogik der Gastfreundschaft, die über bloße Toleranz hinausgeht und auf echte Anerkennung der Andersartigkeit zielt.
Ausblick
Der philosophische Ansatz der Xenagogik gewinnt eine unerwartete Aktualität. Die Lehre vom Umgang mit dem Fremden liefert das gedankliche Rüstzeug für die zentralen Herausforderungen der Jugend- und Erwachsenenbildung. Sie ist mehr als eine akademische Theorie; sie ist ein Handlungsprinzip für eine Pädagogik, die sich in einem Spannungsfeld aus politischer Polarisierung, technologischer Disruption und wachsender psychischer Belastung neu verorten muss.
Die Zukunft des Lernens liegt vor allem in der Kultivierung eines reflektierten Umgangs mit dem Unbekannten. Eine xenagogische Haltung ist dafür die Voraussetzung um eine wirksame Demokratiebildung, die unterschiedliche Perspektiven nicht ausblendet, sondern deren Spannungen produktiv aushält und nutzt. Sie ist ebenfalls grundlegend für die Integration künstlicher Intelligenz, die als neue Form des "Anderen und Fremden" verstanden und kritisch begleitet werden muss.
Nicht zuletzt erfordert die Zunahme psychischer Belastungen ein pädagogisches Klima des Verstehens und der Anerkennung, das Fremdheit im Erleben des Einzelnen nicht pathologisiert, sondern begleitet. Die Bildungslandschaft bewegt sich aktuell in vielen Bereichen weg von standardisierten Antworten und hin zur Stärkung der Ambiguitätstoleranz, der Kompetenz, mit Nichtwissen, Andersartigkeit und vor allem offenen Prozessen konstruktiv umzugehen.
Eine Leseempfehlung dazu: Einführung in das Denken Munasu Duala-Mʼbedys
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro und Microsoft Word mit Copilot verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
