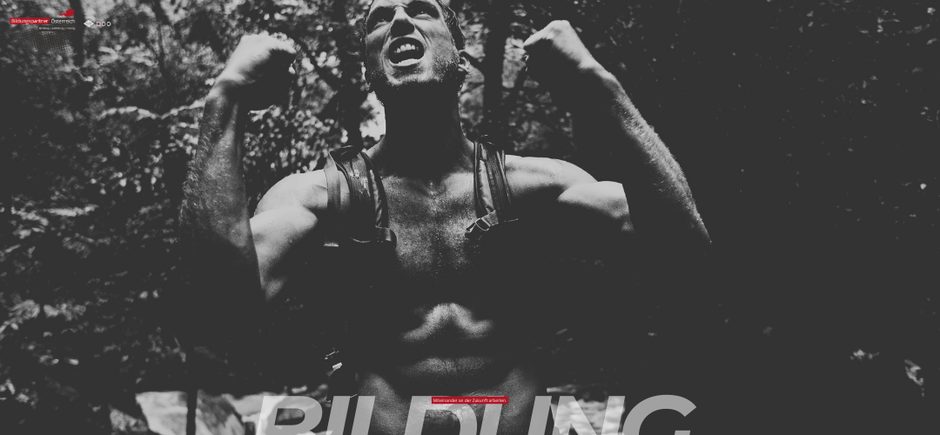
Auffällige Kleidung
Montur ist nicht gleich Kompetenz
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Wer heute nach Angeboten zur Persönlichkeitsentwicklung, nach Naturerfahrungen oder Retreats sucht, begegnet einem auffällig konsistenten Bild. Auf Social-Media-Kanälen und Websites präsentieren sich Trainerinnen und Trainer in einer Ästhetik, die weit über funktionale Sportbekleidung hinausgeht.
Diese Inszenierung ist kein Zufall. Die Wahl der Kleidung in diesem Outdoor-Segment ist bei genauerer Betrachtung ein hochwirksames strategisches Instrument. Sie dient der Konstruktion eines Images, der ideologischen Aufladung des Angebots und verfolgt vor allem kommerzielle Interessen. Anstatt nur praktischen Zwecken zu dienen, wird Kleidung zu einer Uniform, die eine spezifische Botschaft sendet und eine sorgfältig kuratierte Welt erschafft, in die Kundinnen und Kunden eintreten sollen.
Die Uniform als psychologisches Werkzeug der Status-Etablierung
Historisch gesehen war Kleidung schon immer ein machtvolles, nonverbales Signal für Status, Rolle und Zugehörigkeit. Von der Robe eines Richters über den Kittel eines Arztes bis zur Uniform der Soldaten, spezifische Kleidung schafft sofort eine Hierarchie, signalisiert Kompetenz und fordert Respekt ein. Genau dieses psychologische Prinzip macht sich die Coaching-Branche in der Naturszene zunutze.
Ein bewusst gewählter, unkonventioneller, aber konsequent beibehaltener Kleidungsstil fungiert als selbst entworfene Uniform. Diese hebt die Person der Trainierenden aus der Masse der Teilnehmenden heraus, die in standardisierter Funktionskleidung erscheinen. Sie transformiert die Rolle von einem reinen Dienstleistenden zu einer Leitfigur, von Wissenden, von Eingeweihten. Die Uniform schafft eine Aura des Besonderen und etabliert von Beginn an einen Experten und Expertinnen- oder sogar Guru-Status. Sie ist der erste Schritt, um eine symbolische Kompetenz zu vermitteln, die nicht zwangsläufig durch nachweisbare Qualifikationen gedeckt sein muss. Die Kleidung sagt: „Ich bin anders. Ich habe ein tieferes Verständnis. Folge mir.“
Archetypen als Erzählung: Die Geschichten, die Kleidung verkauft
Diese Uniformen sind selten willkürlich, sondern bedienen sich kraftvoller, kulturell verankerter Archetypen. Archetypen sind psychologische Abkürzungen; sie erzählen eine komplette Geschichte, ohne ein Wort zu sagen. Im Outdoor-Coaching haben sich (neben anderen) vor allem zwei dominante Archetypen herauskristallisiert:
1. Der Natur-Schamane / Die moderne Priesterin: Dieser Typus inszeniert sich als tief mit der Erde und einer ursprünglichen Spiritualität verbunden. Gekleidet in Leinen, grober Baumwolle und Wolle, dominieren Erdtöne wie Braun, Ocker und Moosgrün. Oft wird der Look durch handgefertigten Schmuck aus Naturmaterialien, Federn im Haar oder symbolische Tattoos ergänzt. Ein zentrales Element ist das Auftreten barfuß oder in minimalistischem Schuhwerk, was eine direkte, unverfälschte Verbindung zur Natur symbolisieren soll.
-
Die Botschaft: Hier geht es nicht um Lernen oder Bildung, sondern um Heilung, Entschleunigung und die Wiederentdeckung eines „verlorenen Wissens“. Schamanen und Schamaninnen
versprechen einen Zugang zu einer tieferen, wahren Natur des Menschen, die im modernen Leben verschüttet wurde. Die Kleidung ist das Kostüm für diese spirituelle Erzählung. Sie suggeriert
eine Weisheit, die jenseits wissenschaftlicher Erklärungen liegt und verleiht dem Angebot eine mystische, fast sakrale Dimension.
- Die Kritik: Die spirituelle Überlegenheit, die durch dieses Erscheinungsbild projiziert wird, steht in keinem Verhältnis zur tatsächlichen, nachweisbaren Qualifikation. Ein Wochenendkurs in „schamanischer Praxis“ ersetzt keine fundierte psychologische oder pädagogische Ausbildung. Die Inszenierung wird zur Hauptleistung, während die versprochene Transformation vage und unüberprüfbar bleibt.
2. Der Urbane Krieger / Die Survival-Expertin: Dieser Archetyp verkörpert das genaue Gegenteil: Kontrolle, Härte und Disziplin. Die Uniform besteht aus taktischer Ausrüstung, oft in dunklen Farben wie Schwarz, Oliv oder Grau. Cargohosen mit vielen Taschen, robuste Militärstiefel und enganliegende Funktionsshirts prägen das Bild. Die Ästhetik ist vom Militär und von Spezialeinheiten inspiriert und strahlt eine „No-Excuses“-Mentalität aus.
-
Die Botschaft: Das Leben ist ein Kampf, und nur die Harten überleben. Diese Coaches versprechen, die Teilnehmenden durch extreme Herausforderungen zu führen, um sie mental und physisch
zu stählen. Es geht um Resilienz, Selbstoptimierung und das Überwinden von Grenzen. Die Kleidung ist Symbol für eine Ideologie der Stärke und Selbstkontrolle und bedient die Sehnsucht nach
klaren Regeln und autoritärer Führung in einer als chaotisch und komplex empfundenen Welt.
- Die Kritik: Diese militaristische Ästhetik kann eine einschüchternde und exkludierende Atmosphäre schaffen. Sie fördert ein Weltbild, das auf Konkurrenz und Unterwerfung basiert, anstatt auf Kooperation und Selbstfürsorge. Der Fokus auf das „Bedingungslose Durchhalten“ kann gesundheitliche Grenzen missachten und psychischen Druck erzeugen, der einer echten Persönlichkeitsentwicklung entgegensteht.
Fassade statt Kompetenz: Das Geschäftsmodell der inszenierten Authentizität
Hinter diesen sorgfältig konstruierten Fassaden steht meist (Ausnahmen sind selbstverständlich möglich) ein kalkuliertes Geschäftsmodell. Die Uniform ist das zentrale Werbemittel für das, was eigentlich verkauft wird: kein Training, keine Bildung und kein Inhalt, sondern eine Identität. Die Kundschaft bucht nicht nur einen Kurs oder ein Training, sondern die Hoffnung, selbst ein Teil dieser inszenierten Welt zu werden, sei es spiritueller, stärker oder authentischer.
Dieses „Identitätsangebot“ ist hochprofitabel. Es schafft eine emotionale Bindung, die weit über eine normale Beziehung mit Kundschaften hinausgeht. Die paradoxe Logik dahinter: Eine als besonders „authentisch“ und „naturverbunden“ vermarktete Kleidung (mit allem, was dahintersteht) dient der Schaffung eines hochgradig künstlichen Images, das sich perfekt über visuelle Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok vermarkten lässt.
Die Gefahren dieses Modells sind vielfältig: bspw.
-
Die Fassade kaschiert Mängel: Eine charismatische Inszenierung lenkt ehr häufig von fehlenden oder mangelhaften Qualifikationen ab. Während fundiert ausgebildete Fachkräfte ihre
Kompetenz durch transparentes Wissen und erprobte Methodik beweisen, überzeugen diese verkleideten Personen im Outdoor-Gewand primär durch ihr Auftreten. Die beeindruckende Fassade ersetzt
den Inhalt, und die kritische Frage nach der fachlichen Kompetenz rückt in den Hintergrund.
- Die Coaches werden zur Marke: Die Person der Trainierenden wird zur Marke, die ein ganzes Ökosystem von Produkten und Dienstleistungen trägt. Auf den Kurs folgen das Buch, die eigene Kleidungslinie, Nahrungsergänzungsmittel und teure „Mastermind“-Retreats u.a.m. Der Fokus verschiebt sich von der Wissensvermittlung bzw. des Fertigkeitsaufbaues zur Maximierung des Profits der Anbietenden.
Gruppendynamik: Exklusivität, Zugehörigkeit und subtile Kontrolle
Die spezifische Kleiderordnung fungiert als Code, der eine exklusive Gruppe definiert. Sie schafft eine klare Trennung zwischen „uns“ (den Eingeweihten) und „denen“ (die der normalen Außenwelt angehören). Wer zur Gruppe gehören will, passt sich den Codes an, nicht nur äußerlich, sondern oft auch ideologisch.
Anstatt den Zugang zur Natur und zur persönlichen Entwicklung für alle zu öffnen, schaffen solche Trainierenden geschlossene Gemeinschaften, in denen ein starkes Konformitätsdenken herrscht. Die sonderbare Kleidung ist das Erkennungszeichen der In-Group. Das fördert ein elitäres Denken und führt nicht selten zu problematischen Abhängigkeiten. Die Zugehörigkeit zur Gruppe ist an die Loyalität gegenüber den anleitenden Personen gekoppelt. Kritik a diesen Führungspersönlichkeiten wird schnell als Verrat an der Gemeinschaft gedeutet. Echte Autonomie der Teilnehmenden, das eigentliche Ziel von Bildungsprozessen, wird damit untergraben.
Ein Appell zur Mündigkeit: Der kritische Blick hinter die Kulissen
Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Wahl der Kleidung kein Zufall ist, sondern eine gezielte Strategie, die auf tiefsitzende emotionale und psychologische Bedürfnisse abzielt. Der Wunsch nach Zugehörigkeit, Führung und Sinnstiftung wird gezielt angesprochen und kommerzialisiert.
Für Konsumentinnen und Konsumenten ist es daher ratsam, die demonstrativ zur Schau getragene Uniform kritisch zu hinterfragen und die Substanz von der sorgfältig konstruierten Fassade zu trennen. Sie müssen sich folgende Fragen stellen:
- Welche Geschichte erzählt die Kleidung und welche Emotionen will sie in mir auslösen?
- Welche konkreten, nachprüfbaren Qualifikationen (Zertifikate, Ausbildungen, Berufserfahrung) besitzt diese Person?
- Wird hier eine offene Lernumgebung geschaffen, die meine Autonomie stärkt, oder wird eine Abhängigkeit von einer Leitfigur (Leitidee) gefördert?
- Was wird hier wirklich verkauft, eine fachliche Dienstleistung oder ein Lebensgefühl als Produkt?
Der kritische Blick auf die Uniform der Trainierenden ist ein Akt der Mündigkeit und im Besonderen der Selbstfürsorge. Er schützt vor Manipulation und stellt sicher, dass die gebuchte Leistung auf tatsächlichen Kompetenzen und nicht auf einer Show basiert. Echte, nachhaltige Bildungsprozesse im Outdoor-Bereich müssen auf Transparenz, nachprüfbaren Qualifikationen und einer partnerschaftlichen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden mit dem Ziel der Erweiterung der Autonomie beruhen und nicht auf der Verehrung einer künstlich überhöhten Figur.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro und Microsoft Word mit Copilot verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
