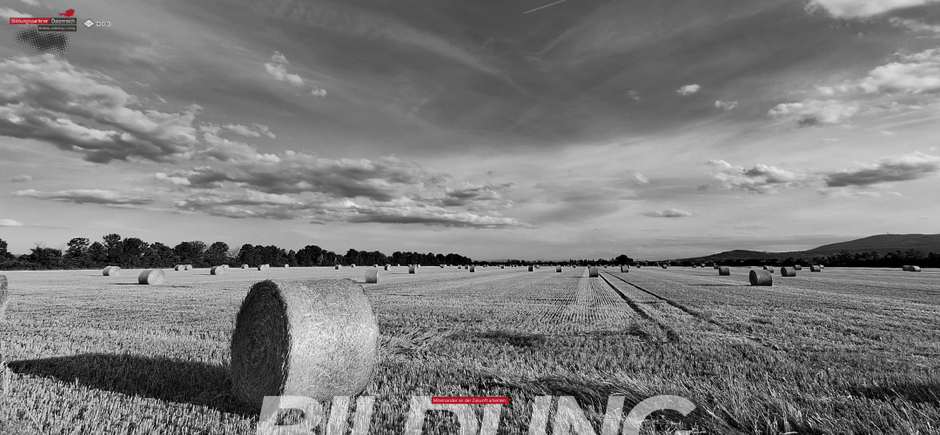
Draußen lernen
Das Potenzial von Outdoor-Formaten
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Die Wahl des Settings ist ein anerkannter Faktor für den Erfolg von Lern- und Entwicklungsprozessen. Während klassische Formate überwiegend in Innenräumen stattfinden, gewinnt die Durchführung von Seminaren, Trainings, Workshops und Coachings in Naturumgebungen an Bedeutung. Dieser Ansatz ist mehr als eine situative Abwechslung; er basiert auf beobachtbaren psychologischen und physiologischen Prinzipien.
Die Verlagerung des Settings nach draußen verändert die Rahmenbedingungen der Interaktion und beeinflusst Lern- und Entwicklungsprozesse auf mehreren Ebenen positiv. Nachfolgend vier zentrale Wirkungsfaktoren, die zur Effektivität von Outdoorformaten die Grundlage bilden.
Wirkfaktor 1: Psychophysiologische Effekte der Naturumgebung
Die Umgebung, in der sich die Teilnehmenden befinden, hat direkten Einfluss auf ihre körperlichen und geistigen Zustände. Naturumgebungen rufen spezifische Reaktionen hervor, die für Lernprozesse in Gruppen und Einzelsettings vorteilhaft sein können (hier nur die beiden wichtigsten).
-
Stressreduktion und kognitive Ressourcen Konzepte wie die Biophilie-Hypothese (Edward O. Wilson: postulierte, dass Menschen eine angeborene
Neigung haben, sich zur Natur hingezogen zu fühlen und mit ihr zu interagieren) und die Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan: ihr
Theorieansatz stellt fest, dass Menschen sich besser von mentaler Anstrengung erholen können, wenn sie Zeit in der Natur verbringen) liefern theoretische Grundlagen für die
stressreduzierende Wirkung von Natur. Studien deuten darauf hin, dass der Aufenthalt in natürlichen Umgebungen z. B. zu einer messbaren Senkung des Stresshormons Cortisol führt. Für die
Praxis in Training, Seminar, Workshop und Coaching bedeutet das: Ein reduziertes Stressniveau erhöht die kognitive Aufnahmefähigkeit und die Offenheit für neue Denk- und Problemlösungsmuster.
Teilnehmende können durch diesen entspannten Zustand leichter auf ihre kreativen und problemlösenden Ressourcen zugreifen.
- Kognitive Unterstützung durch Bewegung Das Gehen im Freien unterscheidet sich fundamental von einer statischen Sitzhaltung und -ordnung in Seminarräumen. Die bilaterale, rhythmische Bewegung des Gehens unterstützt die Verarbeitung von Informationen und Emotionen. Das gilt für Einzelpersonen genauso wie für Gruppenarbeiten in Partnerinnen bzw. Partner- oder Kleingruppen ("Walk and Talk"). Gleichzeitig verändert sich die soziale Dynamik. Konkret wird das Gehen nebeneinander als weniger konfrontativ empfunden als ein direktes Gegenübersitzen, was den Aufbau von Vertrauen und einer positiven Lernatmosphäre fördert.
Wirkungsfaktor 2: Einsatz von realen und symbolischen Interventionen
Während bei Indoor-Formaten primär verbal und mit vorbereiteten Materialien gearbeitet wird, ermöglichen Outdoor-Settings die Einbindung von realen Objekten und erfahrungsorientierten Elementen.
-
Von der abstrakten Sprache zur konkreten Erfahrung Die Natur bietet eine Vielzahl an Objekten und Situationen, die als Analogien oder Metaphern für die Themen der Teilnehmenden genutzt
werden können. Eine Weggabelung kann eine strategische Entscheidung im Team symbolisieren, ein stabiler Baum kann für Team-Ressourcen stehen oder eine Landschaft für das Zusammenspiel vieler
kleinster und kleiner Elemente zu einem harmonischen Gesamtbild. Die Nutzung solcher realen Metaphern ermöglicht auf natürliche Weise eine multisensorische Verarbeitung. Die Folge ist eine
tiefere und nachhaltigere Verankerung der Lerninhalte, da die Erfahrungen an konkrete erinner- und nachvollziehbare, auch körperliche Erlebnisse gekoppelt sind.
- Erfahrungsorientiertes Arbeiten Anstatt Herausforderungen bloß zu beschreiben, zu besprechen und zu diskutieren, können sie im Freien in symbolischer Form direkt bearbeitet werden. Verschiedenste konkrete Teamaufgaben, wie das Lösen von Navigationsaufgaben oder der Bau einer Skulptur mit Naturmaterialien, können praktische Erfahrungen und Erkenntnisse über bspw. Kommunikation, Führung und Kooperation liefern, die weit über das hinausgehen, was in einer klassischen Seminarsituation möglich wäre.
Wirkungsfaktor 3: Kontextwechsel zur Reduktion von Rollenverhalten
Bekannte Umgebungen wie Büros, Besprechungs- oder Seminarräume sind in der Regel stark mit bestimmten Rollen, Hierarchien und vor allem Verhaltenserwartungen verknüpft, was besonders in Team-Workshops oder Führungskräftetrainings eine Rolle spielt.
-
Veränderung von Verhaltensmustern durch einen neutralen Raum Die Natur stellt einen weitgehend neutralen und nicht vorbelasteten Kontext dar. Dieser Wechsel der Umgebung trägt in jedem
Fall dazu bei, dass Teilnehmende ihr gewohntes Rollen- und Umgehensverhalten verändern und im besten Fall ablegen. Dadurch wird in der Regel die Kommunikation offener, direkter und insgesamt
ist der Umgang miteinander weniger von Hierarchien geprägt.
- Förderung von divergentem Denken Die Komplexität und Vielfalt von Naturumgebungen regt zudem divergentes Denken, also sich offen, unsystematisch und experimentierfreudig mit einem Thema oder Problem zu beschäftigen, an. Dieser Zustand ist eine wichtige Voraussetzung für kreative Problemlösungen und die Entwicklung neuer Perspektiven, ein zentrales Ziel in vielen Seminaren, Trainings und Workshops.
Wirkungsfaktor 4: Konzeptionelles Design als Grundlage des Lernerfolgs
Ein weit verbreitetes Missverständnis ist immer noch, dass die Wirksamkeit von Outdoor-Trainings primär auf spektakulären Übungen oder Spielen beruht. Tatsächlich ist jedoch nicht die einzelne Aktivität entscheidend, sondern die pädagogische Gesamtkonzeption, in die sie eingebettet ist. Der nachhaltige Erfolg hängt von der prozessorientierten Dramaturgie des gesamten Formats ab.
-
Prozess vor Inhalt: In professionell begleiteten und angeleiteten Outdoor-Trainings sind die Übungen, die Spiele und Aufgaben selbst nur so etwas wie die Auslöser für den eigentlichen
Lernprozess. Der Fokus liegt vielmehr darauf, wie eine Gruppe eine Aufgabe löst: Wie wird kommuniziert? Welche Rollen bilden sich? Wie geht das Team mit unvorhergesehenen
Schwierigkeiten um? Diese Beobachtungen aus dem Prozess werden zum zentralen Lerninhalt, der in anschließenden Reflexionsphasen bearbeitet und mit dem Lebens- und Berufsalltag verknüpft
wird.
- Der rote Faden: Effektive Outdoor-Formate folgen zudem immer einem "roten Faden", der sich konsequent an den Zielen der Teilnehmenden bzw. der Auftraggebenden ausrichtet. Jede Sequenz, vom Ankommen über die Arbeitsphasen bis zum Abschluss, ist Teil eines didaktisch begründeten Designs. Das unterscheidet ein professionelles Arbeiten in der Natur von einem reinen Incentive- oder Event-Programm, bei dem die Aktivität als Selbstzweck im Vordergrund steht. Die eigentliche Kunst liegt darin, einen Rahmen zu schaffen, in dem relevante Erfahrungen und Erkenntnisse entstehen und für einen Transfer nutzbar gemacht werden können.
Von der Wirkung zur Anwendung: Professionalität in Outdoor-Formaten
Die effektive Nutzung der beschriebenen Faktoren braucht jedoch mehr als einen (gemeinsamen) einfachen Ausflug in die Natur. Professionelle Outdoor-Trainings, Seminare, Workshops und Coachings basieren auf fundierten didaktisch-methodischen Kompetenzen der Trainerinnen und Trainer. Dazu gehören eine gezielte Auftragsklärung, die Kompetenz, Naturmetaphern prozessorientiert einzusetzen, eine adäquate Sicherheits- und Risikoplanung sowie die Kompetenz, die gemachten Erfahrungen gezielt zu reflektieren und den Transfer der Erkenntnisse in den Lebens- und Berufsalltag der Teilnehmenden zu begleiten und sicherzustellen.
Eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesen Themen findet sich in einschlägiger Fachliteratur, wie beispielsweise dem Praxishandbuch „Outdoorpädagogik: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für outdoorpädagogisches Denken, Planen und Handeln“ von Manfred Hofferer und Renate Fanninger (2011). Hier wird die Notwendigkeit einer soliden Ausbildung sichtbar, um die Potenziale des Naturraums professionell nutzen zu können.
Zusammenfassung Insgesamt lässt sich festhalten, dass Lern- und Entwicklungsformate in Naturumgebungen ihre Wirksamkeit aus einer Kombination von unterschiedlichen Faktoren beziehen: Sie schaffen u. a. durch Stressreduktion eine positive physiologische Ausgangslage (Faktor 1), sie erweitern das methodische Spektrum um erfahrungs- und erkenntnisorientierte Aufgaben, Projekte und Interventionen (Faktor 2) und sie können durch den Kontextwechsel festgefahrene Rollen- und Denkmuster aufweichen (Faktor 3). Und schließlich verankert eine durchdachte pädagogische Gesamtkonzeption (Faktor 4) diese Elemente, dadurch dass der Prozess immer über die einzelne Aktivität gestellt wird. Bei professioneller Anwendung stellen Trainings in und mit der Natur eine sinnvolle und vor allem wirksame Ergänzung zu klassischen Indoor-Formaten dar.
Für Trainerinnen und Trainer, Beraterinnen und Berater, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Coaches, die ihre Kompetenzen in diesem Bereich systematisch erweitern möchten, bietet unsere zertifizierte Ausbildung „Outdoorpädagogik“ eine fundierte Grundlage, um Natur als Rahmen, Ort und Setting für diverse Bildungsformate professionell nutzen zu können. Weitere Informationen zu den Inhalten und der Methodik finden Sie hier.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro und Microsoft Word mit Copilot verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
