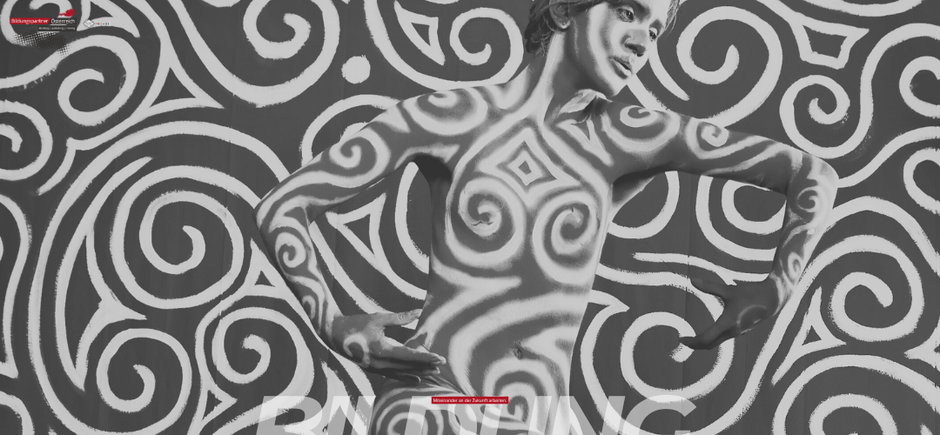
Das Gedächtnis...
... sitzt nicht nur im Kopf
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Das Konzept des verkörperten Wissens bzw. des verkörperten Gedächtnisses postuliert, dass Wissen und Erinnerungen nicht ausschließlich als abstrakte, symbolische Repräsentationen im Gehirn gespeichert sind. Stattdessen sind sie untrennbar mit körperlichen Erfahrungen, Interaktionen mit der Welt sowie sensorischen und motorischen Systemen verwoben. Das bedeutet, dass der Körper und die physische Existenz eine entscheidende Rolle bei der Formung, Speicherung und dem Abruf von Wissen und Gedächtnis spielen.
Diese Denkkonzeption steht im Kontrast zu traditionellen kognitiven Theorieansätzen, die das Gehirn oft als reine Informationsverarbeite Einheit betrachtet, die vom Körper mehr oder weniger getrennt ist. Verkörpertes Wissen betont dagegen die Verbundenheit und wechselseitige Abhängigkeit von Geist und Körper.
Kernaspekte des verkörperten Wissens
Die Verbindung zwischen Körper und Kognition manifestiert sich in verschiedenen Bereichen:
Sensorisch-Motorische Basis
Wissen über die Welt und andere Menschen wird maßgeblich durch sensorische Erfahrungen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) und motorische Handlungen (Greifen, Laufen, Sprechen etc.) geprägt. Beim Abruf von Erinnerungen respektive dem Verständnis von praktischen und theoretischen Konzepten werden häufig dieselben sensorischen und motorischen Areale im Gehirn aktiviert, die an der ursprünglichen Erfahrung beteiligt waren.
- Beispiel: Die Vorstellung einer Tasse Kaffee aktiviert unbewusst das Gefühl von Wärme in den Händen, den Geruch und, wenn man sich darauf einlässt, die Bewegung des Zum-Mund-Führens der Tasse.
Implizites und Prozedurales Wissen
Ein signifikanter Anteil des verkörperten Wissens ist implizit, d.h., es ist selten bewusst und verbalisierbar, sondern manifestiert sich in Handlungen und Verhaltensweisen.
- Prozedurales Gedächtnis: Klassische Beispiele umfassen das Fahrradfahren, das Schwimmen oder das Spielen eines Musikinstruments. Dabei handelt es sich um körperlich verankerte Routinen, die ohne bewusste Anstrengung abgerufen werden. Das "Wissen" über diese Tätigkeiten ist in der Koordination und dem Gleichgewicht des Körpers verankert, und sehr viel weniger in einer mentalen Anleitung.
Räumliches Wissen und Orientierung
Das Verständnis von Raum und Navigation ist eng mit der körperlichen Präsenz und Bewegung im Raum verbunden. Die Orientierung erfolgt relativ zum eigenen Körper (links, rechts, vorne, hinten).
- Beispiel: Eine Landkarte wird erst dann vollständig erfasst, wenn eine Verortung des eigenen Standpunkts und eine entsprechende Imagination potenzieller Bewegungen möglich ist.
Emotionen und Körpergefühle
Emotionen sind ebenso nicht nur mentale Zustände, sondern immer auch mehr oder weniger starke körperliche Empfindungen (bspw. Herzklopfen bei Angst, Wärme bei Freude usw.). Die Erinnerung an emotionale Ereignisse, Erlebnisse und Erfahrungen ist tief mit diesen körperlichen Empfindungen verknüpft.
- Somatische Marker: Dieser von Antonio Damasio (Ich fühle, also bin ich) geprägte Begriff beschreibt, dass in der Gegenwart frühe und frühere emotionale Erfahrungen körperliche Reaktionen erzeugen, die Entscheidungen in zukünftigen Situationen beeinflussen.
Soziale Interaktion und Kommunikation
Die Fertigkeit und Kompetenz zur Interpretation von Körpersprache, zum Verständnis von Gesten und zur empathischen Reaktion basiert stark auf verkörpertem Wissen über menschliche Interaktionen und die physikalischen Manifestationen von Emotionen und Absichten.
- Spiegelneuronen: Diese Neuronen spielen eine Rolle beim Verstehen und Nachahmen der Handlungen anderer, was zumindest auf ein verkörpertes Mitschwingen zwischen Individuen hindeutet.
Kognitive Semantik und Metaphern
Auch abstrakte Konzepte werden durch körperliche Metaphern verstanden. Beispiele dafür sind "aufwärts" als positiv oder "abwärts" als negativ; "nahe" als intim oder "fern" als distanziert. Diese Metaphern haben ihre Wurzeln in körperlichen Empfindungen und Erfahrungen in der konkreten Mit- und Umwelt.
Bedeutung des Konzepts
Das Konzept des verkörperten Wissens hat weitreichende Implikationen für verschiedene Fachgebiete:
- Verständnis menschlicher Kognition: Es bietet ein anschauliches Modell des Denkens, Lernens und Erinnerns, das über rein symbolische Ansätze hinausgeht.
- Pädagogik und Lernen: Verkörperte Lernansätze, die Bewegung, Handlungen und sinnliche Erfahrungen integrieren (z.B. "Learning by Doing"), können die Effektivität verstärken, da sie natürliche Lernmechanismen nutzen.
- Therapie und Rehabilitation: Im Rahmen der Genesung von Verletzungen oder Traumata kann das Bewusstsein für die Rolle des Körpers bei der Modell- und Gedächtnisbildung neue therapeutische Strategien eröffnen.
- Design und Interaktion: Die Gestaltung von Produkten und Umgebungen profitiert vom Wissen darüber, wie Menschen physisch mit Objekten und in und mit Räumen interagieren und wie dieses Wissen ihre Wahrnehmung und Nutzung beeinflusst.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass "Verkörpertes Wissen bzw. Gedächtnis" die Erkenntnis darstellt, dass der Geist nicht vom Körper getrennt ist, sondern mit ihm verbunden agiert. Der Körper fungiert nicht lediglich als Gefäß für das Gehirn, sondern ist ein integraler Bestandteil des Denk-, Lern- und Erinnerungsprozesses. Es handelt sich vielmehr um ein dynamisches und interaktives System, in dem Wissen durch und in der Interaktion mit der physischen und sozialen Umwelt entsteht und gespeichert wird.
Und damit bietet der Ansatz des verkörperten Wissens eine belastbare Basis und Erklärung für die Wirksamkeit und den Zu- und Umgang sowie den gezielten Einsatz outdoorpädagogischer Methoden (Im Sinne der Outdoorpädagogik und nicht anderer in der Natur arbeitenden Ansätze). Er liefert ein fundiertes theoretisches Gerüst, das die zentrale Rolle des Körpers als integralen Bestandteil des Lern- und Gedächtnisprozesses hervorhebt. Das untermauert und begründet die outdoorpädagogische Praxis in und mit der Natur auf wissenschaftlicher Ebene.
Und: Es ist wichtig zu betonen, dass das Konzept des verkörperten Wissens weder ein Allheilmittel noch der Weisheit letzter Schluss ist. Daher müssen Frau, Mann und Divers stets auch die Perspektiven ihrer Kritikerinnen und Kritiker in die Betrachtung einbeziehen. Bspw. konnten Studien, die als wichtige Belege für die verkörperte Kognition galten (insbesondere im Bereich des "Social Priming"), in neueren Replikationsstudien nicht immer bestätigt werden. Das wirft Fragen nach der Robustheit bestimmter empirischer Befunde auf und fordert eine kritische Überprüfung.
Zwei Lesetipps zum Thema, die sich mit dem Konzept des verkörperten Wissens und Gedächtnisses auseinandersetzen:
-
"Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn" von Antonio R. Damasio: Damasio, A. R. (2004). Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn.
List.
Antonio Damasio ist ein Neurowissenschaftler, der das Konzept der somatischen Marker populär gemacht hat, eine Facette des verkörperten Wissens. In diesem Buch argumentiert er, dass Emotionen und körperliche Empfindungen nicht von rationalen Entscheidungsprozessen getrennt sind, sondern untrennbar mit ihnen verbunden. Damasio zeigt anhand von Fallstudien und Forschungsergebnissen, wie körperliche Signale Gedanken und Entscheidungen beeinflussen und wie ein Mangel an diesen körperlichen Rückmeldungen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Vernunft führen kann. Das Buch bietet eine fundierte und zugängliche Erklärung, wie der Körper und die Emotionen das Denken und das Gedächtnis prägen.
-
"Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought" von George Lakoff und Mark Johnson: Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the
flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. Basic Books.
Diese Arbeit ist ein Standardwerk für das Verständnis des verkörperten Geistes aus einer sprachwissenschaftlichen und philosophischen Perspektive. Lakoff und Johnson argumentieren, dass selbst abstrakte Konzepte und logisches Denken tief in körperlichen Erfahrungen verwurzelt sind. Sie zeigen, wie grundlegende Metaphern (wie "Zeit ist Geld" oder "Ideen sind Pflanzen") ihren Ursprung in unseren sensorischen und motorischen Interaktionen mit der Welt haben. Das Buch beleuchtet, wie Körperlichkeit kognitiven Fertigkeiten und Kompetenzen formt und wie das traditionelle Annahmen über Rationalität und objektives Wissen infrage stellt. Es ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der verkörperten Semantik und der Rolle des Körpers in der Kognition.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 4.0, Gemini 2.5 Flash und Microsoft Word verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
