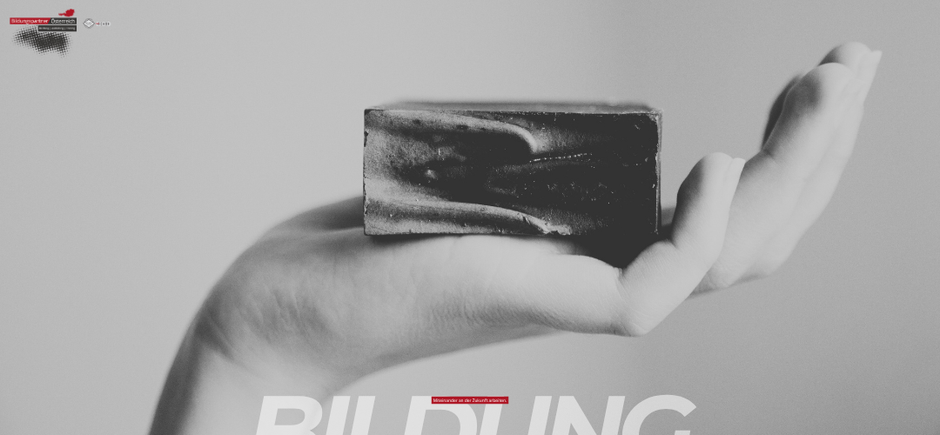
Was ist das Gemeinsame?
Was ist das Verpflichtende?
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Die außerinstitutionelle Erwachsenenbildung in Österreich ist ein vielfältiges System, das unterschiedlichste Lernräume und -möglichkeiten jenseits formaler Bildungswege schafft und zur Verfügung stellt. Sie richtet sich an Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, Berufs- und Lebenslagen und umfasst Settings wie Volkshochschulen, private Akademien, betriebliche Weiterbildungsstätten und Angebote von Erwachsenenbildenden im freien Markt.
Insgesamt werden diese Angebote von einem ethischen Anspruch getragen, der davon ausgeht, dass Lernprozesse nicht nur Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln, sondern individuelle Entwicklung, gesellschaftliche Teilhabe und demokratische Orientierung anregen, fördern und stärken.
In der Praxis stellt sich jedoch die Frage, wie diese Ansprüche konkret eingelöst werden können und unter welchen Bedingungen sie in Gefahr geraten.
Warum Ethik in der Erwachsenenbildung notwendig ist
Erwachsenenpädagogisches Handeln berührt immer auch grundlegende Fragen menschlichen Zusammenlebens: Wie frei darf eine Person über ihren Lernweg entscheiden? Wie lassen sich Teilhabe und Zugang gerecht gestalten? Und wie viel Einfluss dürfen ökonomische und/oder politische Interessen auf Bildungsmaßnahmen und -ziele nehmen?
Der Anspruch, ethisch zu handeln, ergibt sich nicht nur aus der pädagogischen Geschichte und Tradition, sondern auch aus der gesellschaftlichen Verantwortung, die Bildung trägt. Doch gerade in der außerinstitutionellen Bildung fehlt bislang eine verbindliche Ethik. Die vorhandenen Regelwerke, etwa das Bundesgesetz von 1973, die Qualitätsstandards von Ö-Cert oder die Leitbilder großer Bildungsträger, formulieren zwar ethische Grundprinzipien, sind jedoch nicht flächendeckend normierend. Das führt dazu, dass ethisches Handeln stark vom individuellen Engagement der Lehrenden und/oder der Organisationskultur abhängt. Das birgt in jedem Fall Risiken: Unklarheiten, Intransparenz und widersprüchliche Zugänge und Praktiken können das Vertrauen der Lernenden untergraben.
2. Prinzipien ethischen Handelns im Überblick
Zentrale ethische Grundprinzipien, die in der Erwachsenenbildung gelten (und aus benachbarten Professionen wie der Sozialen Arbeit, der Psychologie oder der Medizin übernommen werden können), sind:
-
Autonomie und Selbstbestimmung: Lernende müssen als entscheidungskompetente und -fähige Subjekte wahrgenommen werden. Erwachsenenbildung darf nicht bevormunden oder paternalistisch
handeln. Bildung muss Wahlmöglichkeiten eröffnen und individuelle Lernwege respektieren und fördern. Gleichzeitig braucht Selbststeuerung unterstützende Strukturen, denn nicht jede Person
kann diese Rolle gleichermaßen ausfüllen, etwa bei instabilen Lebensbedingungen oder in Situationen psychischer oder sozialer Belastung.
-
Nicht-Schadens-Prinzip und Fürsorgepflicht: Bildungsangebote dürfen keinen Schaden verursachen, weder physisch, psychisch oder sozial. Das gilt besonders für Inhalte, die mit
Manipulation, pseudowissenschaftlichen Aussagen oder ausgrenzenden Haltungen arbeiten. Die Ablehnung esoterischer Praktiken in den Leitbildern großer Träger zeigt die Sensibilität gegenüber
solchen Risiken wenngleich in der Praxis derselben Institutionen im Angebot Abweichen festzustellen sind.
-
Gerechtigkeit und Diversität: Bildungszugang darf nicht vom Einkommen, Herkunft, Geschlecht, Behinderungen oder Aufenthaltsstatus (u.a. Merkmalen) abhängig gemacht werden. Es bedarf
aktiver Maßnahmen, um Benachteiligung und Ausgrenzungen abzubauen. Dazu gehört auch, Sprache, Lernformate und Methoden so zu gestalten, dass sie inklusiv sind. Die bloße Existenz offener
Angebote reicht nicht, es braucht vielmehr gezielte Ansprache, barrierearme Zugänge und Gestaltungen der Bildungssuchenden und strukturelle sowie finanzielle Unterstützung.
-
Vertraulichkeit und Datenschutz: Lern- und Entwicklungsprozesse sind sensibel. Vertrauen kann nur entstehen, wenn mit persönlichen Daten, Äußerungen und digitalen Spuren sorgsam
umgegangen wird. Im Kontext digitaler Bildung entstehen neue Risiken: Plattformanbietende, Analyse-Software oder automatisierte Lernkontrollen greifen tief in die Privatsphäre der Lernenden
ein. Lehrende müssen solche Entwicklungen kennen, verstehen und die Interessen der Lernenden aktiv schützen.
- Qualität und Professionalität: Ethik verlangt eine ständige Überprüfung der eigenen Praxis. Lehrende sind nicht nur Wissens- und Könnens Vermittelnde, sondern pädagogisch und ethisch Handelnde. Qualitätssicherung darf daher nicht rein formal oder bürokratisch sein, sondern muss als ethische Verpflichtung gegenüber den Lernenden verstanden und umgesetzt werden.
3. Ethische Herausforderungen in der außerinstitutionellen Bildungspraxis
Die Umsetzung dieser 5 Prinzipien (im Detail sind es selbstverständlich wesentlich mehr) ist im Alltag mit Spannungsfeldern konfrontiert. Drei besonders relevante Problemfelder lassen sich identifizieren:
-
a) Ökonomisierung und Marktdruck: Viele Bildungsangebote stehen unter wirtschaftlichem Druck. Förderlogiken, Projektlaufzeiten und Verwertungsanforderungen prägen zunehmend die
Programmgestaltung. Die Gefahr: Bildung wird zur Ware, Lernende zu bloßen „Kundinnen und Kunden“ und noch schlimmer zu „Fallzahlen“ in Bildungsstatistiken. Formate wie „Zielgruppenmaßnahmen“
(bspw. im Sprachentwicklungsbereich) fördern mehr eine Defizitorientierung stigmatisieren die Lernenden. Wenn etwa Menschen mit prekärem Bildungs- und Erwerbsverlauf ausschließlich über ihr
„Fehlen an Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen“ adressiert werden, gerät der Mensch hinter der Kategorie aus dem Blick. Ethisches Handeln muss hier bedeuten, nicht dem Marktdenken zu folgen,
sondern Bildung als Ermöglichung von Selbstverwirklichung zu gestalten.
-
b) Digitalisierung und technologische Steuerung: Digitale Tools bieten zwar neue Chancen und Möglichkeiten: man denke an Zugänglichkeit, Flexibilität oder individuelle Anpassung.
Gleichzeitig entstehen aber neue ethische Fragen: Wer kontrolliert Lernverhalten? Welche Daten werden erhoben? Wo beginnt Überwachung? Systeme wie Classroom Analytics, die Aufmerksamkeit oder
Emotionen erfassen wollen, operieren in der Regel mit vereinfachten Annahmen, die diversitätsblind sind. Zudem droht eine technikgetriebene Steuerung von Bildungsprozessen, die pädagogische
Beziehung und menschliches Maß, von Beziehung getragener Einschätzung und Prüfung verdrängt. Ethische Bildung muss sich der Digitalisierung nicht verweigern, aber sie in jedem Fall kritisch
begleiten und im Sinne und zum Wohle der Lernenden einsetzen.
- c) Umgang mit Bildungsbenachteiligung und Lebensübergängen: Erwachsenenbildung begegnet Menschen häufig in Umbruch- und Veränderungsphasen: Arbeitslosigkeit, Migration, Krankheit, Pflegeverantwortung. In solchen Übergängen ist Lernen keineswegs immer planbar oder hochprozentig zielgerichtet. Eine ethisch sensible Bildungspraxis muss Liminalität, also das Dazwischen, den Zustand in dem alte Strukturen und Gewissheiten aufgelöst werden, bevor neue entstehen, aushalten. Sie darf nicht auf schnelle „Normalisierung“ abzielen, sondern muss Raum für Orientierungs- und Entwicklungsprozesse geben. Das verlangt von Lehrenden nicht nur Empathie, sondern auch eine reflektierte Haltung zu aktuellen gesellschaftlichen Normen und Erwartungen.
4. Warum eine verbindliche Bereichsethik notwendig ist
Die genannten Herausforderungen zeigen: Es reicht nicht, ethisches Handeln dem Einzelfall zu überlassen. Was fehlt, ist ein verbindlicher Rahmen, eine Bereichsethik, die Orientierung gibt, Reflexion fördert und Standards für die Praxis setzt und die nicht bloß Lippenbekenntnisse darstellen. Eine solche Ethik müsste aus dem Dialog von Wissenschaft, Praxis und Politik entstehen. Sie könnte auf vorhandenen Prinzipien aufbauen, müsste aber den spezifischen Kontext der Erwachsenenbildung berücksichtigen: die Ausgangslagen, die Heterogenität der Zielgruppen, die Berücksichtigung der Lebenssituationen der Lernenden, die Freiwilligkeit des Lernens, die Vielfalt der Anbieter und die gesellschaftliche Relevanz.
Ein Ethik-Kodex hätte mehrere Funktionen:
-
Er bietet Orientierung für Lehrende im Umgang mit Dilemmata. Wenn z.B. Lehrende merken, dass eine Person stark überfordert ist, stellt sich die Frage, ob man die Lernziele
für die Person anpassen oder den Kursverlauf für alle ändern soll. Ein Ethik-Kodex kann dabei unterstützen, Entscheidungen nicht nur pragmatisch oder nach Bauchgefühl zu treffen, sondern auf
Grundlage ethischer Prinzipien wie Fürsorge, Gerechtigkeit oder Selbstbestimmung. Kurz gesagt: Das hilft, Unsicherheiten zu verringern und begründete Entscheidungen in moralisch komplexen
Situationen zu treffen.
-
Er ermöglicht Organisationen eine transparente Kommunikation ihrer Werte. Ein Ethik-Kodex hilft Anbietenden dabei, klar und nachvollziehbar darzustellen, welche Werte und
Grundhaltungen ihr pädagogisches Handeln leiten. Das bedeutet konkret: Anbietende können mit einem solchen Kodex nach außen zeigen, wofür sie stehen, etwa für Offenheit, Inklusion,
wissenschaftliche Fundierung oder Ablehnung von Diskriminierung. Das schafft Vertrauen bei Lernenden, Kooperationspartnerinnen und -partnern und (im besten Fall auch bei) Förderstellen.
Zugleich gibt es auch intern Orientierung, z. B. bei der Auswahl von Lehrinhalten oder dem Umgang mit Konflikten.
-
Er schafft Vertrauen bei den Lernenden. Das bedeutet, dass ein schriftlich festgehaltener und öffentlich zugänglicher Verhaltensrahmen, also ein Ethik-Kodex, dazu beiträgt,
dass Personen, die an Bildungsangeboten teilnehmen, Vertrauen in die Anbietenden und deren Mitarbeitende haben können. Im konkreten Zusammenhang der Erwachsenenbildung heißt das: (a) Lernende
wissen, welche Werte und Regeln in der Bildungseinrichtung gelten (z. B. Respekt, Nichtdiskriminierung, Datenschutz). (b) Sie können davon ausgehen, fair, respektvoll und verantwortungsvoll
behandelt zu werden. (c) Sie haben Orientierung und Sicherheit, wie mit sensiblen Themen, Daten oder Konflikten umgegangen wird. (d) Sie erleben die Anbietenden, als verlässlich und
transparent, was die Gestaltung von Lernprozessen betrifft. Kurz gesagt: Ein Ethik-Kodex macht das pädagogische Selbstverständnis sichtbar und stärkt so die Vertrauensbasis zwischen Lernenden
und Lehrenden, eine zentrale Voraussetzung für gelingendes Lernen im Erwachsenenalter.
-
Er unterstützt die Professionalisierung des Berufsbildes „Erwachsenenbildner: in. In jedem Fall trägt ein verbindlicher Ethik-Kodex dazu bei, den Beruf der
Erwachsenenbildenden als anerkannten, fachlich fundierten und verantwortungsvollen pädagogischen Beruf zu stärken und weiterzuentwickeln. Konkret heißt das: Ein Ethik-Kodex gibt klare
Richtlinien für verantwortungsvolles berufliches Handeln vor. Wenn Lehrende in der Erwachsenenbildung sich an solche professionellen Standards halten, fördert das: (a) Verlässlichkeit und
Qualität der Bildungsarbeit, (b) gesellschaftliche Anerkennung des Berufs, (c) Orientierung im Umgang mit schwierigen Situationen, (d) Abgrenzung von unqualifizierten oder zweifelhaften
Anbietenden. Das trägt dazu bei, dass der Beruf nicht als Nebenjob oder bloßes „Vermitteln von Inhalten“ verstanden wird, sondern als professionelle, reflektierte pädagogische Tätigkeit mit
gesellschaftlicher Verantwortung. Das stärkt auch die Position von Lehrenden gegenüber Auftraggebern, Förderstellen und Institutionen.
- Er erleichtert die Abstimmung von Qualitätssicherung, Förderpolitik und Programmgestaltung mit ethischen Zielen. Ein Ethik-Kodex hilft dabei, die unterschiedlichen Bereiche der Erwachsenenbildung, nämlich die Qualitätssicherung, Förderpolitik und Programmgestaltung, besser aufeinander abzustimmen, sodass sie alle nach denselben ethischen Grundsätzen ausgerichtet sind. Im Einzelnen heißt das: (a) Qualitätssicherung soll nicht nur formale Standards überprüfen, sondern auch prüfen, ob Bildungsangebote fair, inklusiv und respektvoll sind. (b) Förderpolitik (z. B. staatliche Zuschüsse) können sich an ethischen Werten orientieren, etwa indem sie keine Projekte unterstützt, die diskriminierend oder rein marktorientiert sind. (c) Programmgestaltung (also Inhalte und Formate der Kurse) kann gezielt darauf ausgerichtet werden, dass sie ethisch verantwortungsvoll, diskriminierungsfrei und an der Gesellschaft Teilhabe fördernd für die Teilnehmenden sind. Ein Ethik-Kodex schafft also eine gemeinsame ethische Orientierung für all diese Bereiche und hilft, Zielkonflikte oder Unklarheiten zu vermeiden.
Ausblick
Die ethische Reflexion in der außerinstitutionellen Erwachsenenbildung steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Die Komplexität gesellschaftlicher Veränderungen, die zunehmende Bedeutung digitaler Formate und der wachsende wirtschaftliche Druck machen deutlich: Ohne eine systematische, praxisnahe und verbindliche Auseinandersetzung mit ethischen Fragen der Bildung in diesem Bereich bleibt Erwachsenenbildung hinter ihrem eigenen Anspruch zurück.
Eine zukünftige Ethik muss daher nicht nur Prinzipien benennen, sondern konkrete Handlungsspielräume aufzeigen, Unsicherheiten anerkennen und vor allem Engagement und Verantwortungsbewusstsein der handelnden Personen fördern. Bildungsträger, Politik und Lehrende sind gleichermaßen gefordert, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Nur so kann Erwachsenenbildung ihrem gesetzlichen Auftrag (Bildung ist ein öffentliches Gut und nicht nur Instrument zur ökonomischen Verwertbarkeit) gerecht werden. Es dient vor allem zur Stärkung von Mündigkeit, Teilhabe und individueller Entwicklung.) gerecht werden, als Ermöglichungsraum für selbstbestimmtes, gerechtes und menschenwürdiges Lernen.
Das bedeutet auch, dass sichergestellt werden muss, dass auch formalrechtlich zulässige Ausbildungen, die nicht öffentlichen Förderrichtlinien unterliegen, den Grundprinzipien der öffentlich verantworteten Erwachsenenbildung entsprechen. Aus bildungsethischer Sicht müssen Angebote, die geltende ethische und pädagogische Standards nicht einhalten, infrage gestellt werden. Das gilt in jedem Fall für den privatwirtschaftlichen Kontext, wo klare Kennzeichnungen, transparente Inhalte und der Verzicht auf pseudowissenschaftliche Aussagen essenziell sind, um Bildungsinteressierte vor Irreführung zu schützen.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 4.0, Gemini 2.5 Flash und Microsoft Word verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
