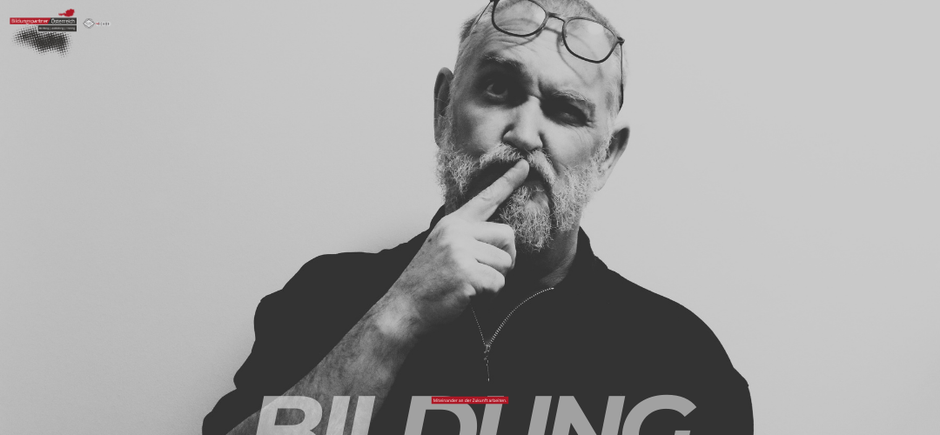
Eine kritische Betrachtung
Ist tatsächlich drinnen, was außen draufsteht?
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Es steht außer Zweifel, dass Vera F. Birkenbihl (1946 bis 2011) den Diskurs über und die Auseinandersetzung mit Lernen im deutschsprachigen Raum nachhaltig geprägt hat. Vor allem ihre charismatischen Art und der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte vermeintlich einfach darzustellen, begeisterte (zum Teil noch heute) ein Millionenpublikum. Begriffe wie „gehirn-gerechtes Lernen“ wurden durch sie populär und versprachen einen revolutionär einfachen Zugang zu Wissen und Fremdsprachen. Ihre Bücher sind Bestseller und ihre aufgezeichneten Vorträge werden nach wie vor millionenfach im Internet aufgerufen.
Die enorme Reichweite und ihr Status als eine der bekanntesten Trainerinnen im Bereich des Lernens erfordern jedoch eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung aus einer pädagogisch-wissenschaftlichen Perspektive. Während der motivationale Aspekt ihrer Arbeit unbestritten ist, offenbart eine fachliche Analyse erhebliche Mängel in Bezug auf die wissenschaftliche Fundierung, methodische Stringenz und gesellschaftliche Verantwortung ihrer Inhalte. 4 Beispiele dazu:
Der Mythos „Gehirn-Gerecht“: Ohne empirische Grundlage
Das heute immer noch zentrale Verkaufsargument der Birkenbihl-Methode ist der Anspruch, „gehirn-gerecht“ zu sein. Dieser Terminus suggeriert so etwas wie eine direkte Ableitung ihrer Strategien aus den Erkenntnissen der zu ihrer Zeit modernen Neurowissenschaften. Bei genauerer Betrachtung erweist sich diese Behauptung jedoch als problematisch. Für die spezifischen, von Birkenbihl propagierten Lerntechniken, wie etwa das „De-Kodieren“ von Fremdsprachen oder ihre Assoziationstechniken, fehlen unabhängige, empirische Belege aus der wissenschaftlichen Forschung, die ihre überlegene Wirksamkeit bestätigen würden (Recherche dazu lohnt sich).
Die pädagogische und psychologische Lernforschung basiert auf strengen, überprüfbaren Studien (Peer-Review-Verfahren), welche die Effektivität von Lehrmethoden unter kontrollierten Bedingungen untersuchen. Birkenbihls Ansätze entziehen sich dieser Überprüfung weitgehend. Ihre Erklärungen zur Funktions- und Arbeitsweise des Gehirns stellen stark simplifizierte, zum Teil veraltete oder auch spekulative Interpretationen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse dar. Komplexe Prozesse wie Gedächtnisbildung, neuronale Plastizität und kognitive Verarbeitung werden auf eingängige, aber streng wissenschaftlich unzureichende Modelle reduziert.
Aus fachlicher Sicht ist der Begriff „gehirn-gerecht“ mehr ein Marketinginstrument, das eine wissenschaftliche Legitimität vortäuscht, die es in dieser Form nicht gibt. Die moderne Didaktik spricht stattdessen von lernpsychologisch fundierten, kognitiv aktivierenden oder konstruktivistischen Lernumgebungen, die stets auf belegbaren Theorien, Modellen und Konzepten des Lernens aufbauen. Birkenbihls Methodik basiert hingegen vorrangig auf persönlichen Überzeugungen und anekdotischer Evidenz, was sie von seriösen pädagogischen Konzepten grundlegend unterscheidet.
Stereotype als Fakten: Das Problem pauschaler Geschlechterzuschreibungen
Einer der mit Sicherheit schwerwiegendsten Kritikpunkte an den Inhalten von Vera F. Birkenbihl ist die unkritische und wiederholte Verbreitung von Geschlechterstereotypen. In zahlreichen Vorträgen und Schriften präsentiert sie launig plaudernd tiefgreifende und angeblich biologisch determinierte Unterschiede im Denken, Fühlen und Verhalten von Männern und Frauen als unumstößliche Tatsachen. Diese Darstellungen bedienen ganz stark klassische Rollenklischees, indem sie beispielsweise Personen je nach Geschlecht pauschal unterschiedliche Neigungen zu Sach- oder Beziehungsorientierung, zu linearem oder vernetztem Denken zuschreiben.
Diese Vorgehensweise ist aus mehreren Gründen äußerst problematisch:
-
Mangelnde wissenschaftliche Evidenz: Die Ergebnisse moderner Neurobiologie und Psychologie widerlegen derart simple dichotome Zuschreibungen nicht erst seit heute. Zwar gibt es
statistische Durchschnittsunterschiede zwischen den Geschlechtern in bestimmten kognitiven Bereichen, doch die individuellen Unterschiede innerhalb einer Geschlechtergruppe sind weitaus
größer als die Unterschiede zwischen den Gruppen. Die enorme Plastizität des menschlichen Gehirns zeigt, dass es maßgeblich durch Erfahrung, Lernen und soziokulturelle Kontexte geformt wird
und eben nicht durch ein starres, an das Geschlecht gebundenes evolutionäres Programm.
-
Pädagogische Verantwortungslosigkeit: Bildung hat den Auftrag, Potenziale zu fördern und Individuen n die Lage zu versetzen, unabhängig von stereotypen Erwartungen eigene und
selbstverantwortete Wege zu gehen. Die Präsentation von Klischees als wissenschaftliche Fakten wirkt diesem Ziel diametral entgegen. Sie bestärkt limitierende Vorurteile und beeinflusst die
Selbstwahrnehmung und die beruflichen wie privaten Entscheidungen von Lernenden negativ.
- Förderung von Pseudowissenschaft: Indem stereotype Annahmen mit einem Anstrich von „Gehirnforschung“ versehen werden, wird die sogenannte Pseudowissenschaft salonfähig gemacht. Die Folge ist, dass Lernende ein verzerrtes Bild von Wissenschaft erhalten, bei dem Alltagsbeobachtungen und tradierte Klischees fälschlicherweise den gleichen Stellenwert wie fundierte Forschungsergebnisse erhalten.
Methodische Einseitigkeit versus didaktische Professionalität
Ein weiteres Kennzeichen der Birkenbihl-Methodik ist der Anspruch auf universelle Gültigkeit. Insbesondere ihre Sprachlernmethode wird in der Darstellung als Königsweg für alle Lernenden präsentiert, der das traditionelle „Lernen“ überflüssig macht. Diese Darstellung einer einzigen, überlegenen Methode widerspricht fundamentalen Prinzipien des evaluierten pädagogisch-wissenschaftlichen Denkens.
Professionelles pädagogisches Handeln zeichnet sich durch didaktische und methodische Variabilität aus. Ein Lehrpersonen bzw. Lernbegleitende müssen in der Lage sein, aus einem breiten Repertoire aus Methoden, Verfahren und Techniken sowie Strategien diejenige auszuwählen können, die für die spezifische Situation der Lernenden am besten geeignet ist. Die Wahl des Zugangs, die Gestaltung der Ziele, der Vorgehensweise dem Einsatz von Methoden hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab:
-
Dem Individuum: Vorerfahrungen, Lernvoraussetzungen, Alter, Bildungsanlass, situativer personaler und sozialer Kontext, Zielsetzung, Motivation, unterschiedliche Arten der
Informationsverarbeitung etc.
-
Dem Lerninhalt: Abstrakte Konzepte erfordern andere Zugänge als praktische Fertigkeiten und Kompetenzen oder Aufbau von Faktenwissen.
- Dem Lernziel: Geht es um Reproduktion für bspw. Prüfungen, ein tiefes Verständnis in der Sache, um praktische Anwendbarkeit im Beruf oder um den konkreten Einsatz bei kreativen Problemlösungen?
Birkenbihls Ansatz lässt genau diese Differenzierung vermissen. Ihr Ansatz suggeriert vielmehr eine „One-size-fits-all“-Lösung und wird damit der Komplexität von Lernen und Lernprozessen keinesfalls gerecht. Die überzogenen Versprechen, wie bspw. das Lernen ohne Anstrengung, führen zudem lernendenseitig zu unrealistischen Erwartungen und letztlich zu Demotivation und Frustration, wenn sich der versprochene Erfolg nicht mühelos einstellt.
Die Vermischung mit esoterischen Denkfiguren
Ein zusätzlicher Aspekt, der Vera F. Birkenbihls Arbeit aus wissenschaftlicher Perspektive problematisch macht, ist die offensichtliche Nähe zu esoterischen und spirituellen Konzepten. Dazu vier
Beispiele:
-
Verwendung des Gesetzes der Anziehung (Resonanzgesetz). Fakt ist, dass keinerlei empirische Belege für ein solches universelles "Gesetz" gibt.
Erfolg wird hier von nachprüfbaren Faktoren (z.B. Übung, Strategie, sozioökonomische Bedingungen) auf eine nicht messbare, metaphysische Kraft verlagert. Das ist ein klassisches Merkmal der
Esoterik.
-
Wiederholte Bezüge auf Vorträge der umstrittenen Thesen von Masaru Emoto (japanischer Parawissenschaftler) , der behauptete, dass menschliche Gedanken und Worte die Struktur von
Wasserkristallen beeinflussen können.
-
Spirituelle Umdeutung von „Kaizen“. Sie sprach immer wieder davon, sich dem „Fluss des Lebens“ hinzugeben und durch kleinste Schritte im Einklang mit einer größeren Ordnung zum Ziel zu
gelangen.
- Unwissenschaftlicher Gebrauch von Begriffen wie „Energie“ und „Schwingung“. Vera F. Birkenbihl sprach häufig von der „Energie“, die von Gedanken ausgeht, oder der „Schwingungsebene“, auf der Frau, Mann und Divers sich befinden muss, um erfolgreich zu sein. Diese Terminologie erweckt den Anschein von Naturwissenschaftlichkeit, die sie nicht ist.
Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass Vera F. Birkenbihl legitime psychologische Beobachtungen (z. B., dass eine positive Einstellung hilft) mit esoterischen, nicht falsifizierbaren Behauptungen vermischte. Für die Lernenden wurde und ist es dadurch schwer, zu unterscheiden, wo eine nützliche Lerntechnik aufhört und wo eine spirituelle Weltanschauung beginnt.
In einem pädagogischen Kontext, der auf Aufklärung, kritisches Denken und die Vermittlung von gesichertem Wissen abzielt, ist eine solche Vermengung irreführend und nicht zulässig. Bildung muss Lernende befähigen, zwischen wissenschaftlichen Theorien und metaphysischen Überzeugungen klar zu unterscheiden. Indem diese Grenzen undeutlich sind und verwischt werden, wird maximal unkritisches Denken gefördert.
Fazit: Ein ambivalentes Erbe
Das Erbe von Vera F. Birkenbihl ist ambivalent. Ihr Verdienst liegt unzweifelhaft darin, unzählige Menschen für das Thema Lernen neu motiviert und ihnen die Angst vor komplexen Themen genommen zu haben. Ihre Kompetenz als exzellente Kommunikator- und Vermittlerin war herausragend.
Aus einer sachlich-fachlichen Perspektive muss ihre Lehre jedoch kritisch betrachtet werden. Die fehlende wissenschaftliche Grundlage, die Verbreitung unhaltbarer Geschlechterstereotype, die methodische Einseitigkeit und vor allem die Nähe zur Esoterik machen ihre Ansätze für einen professionellen pädagogischen Kontext ungeeignet. Ihr Werk ist primär der Ratgebenden- und Infotainment-Literatur zuzuordnen, nicht der seriösen Fachliteratur. Für Lehrende, Lernende und alle, die sich ernsthaft mit effektiven Lernstrategien auseinandersetzen möchten, ist es daher unerlässlich, ihre populären Thesen kritisch zu hinterfragen und sich stattdessen an den Erkenntnissen der etablierten Bildungs- und Kognitionswissenschaften zu orientieren.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro und Microsoft Word mit Copilot verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
