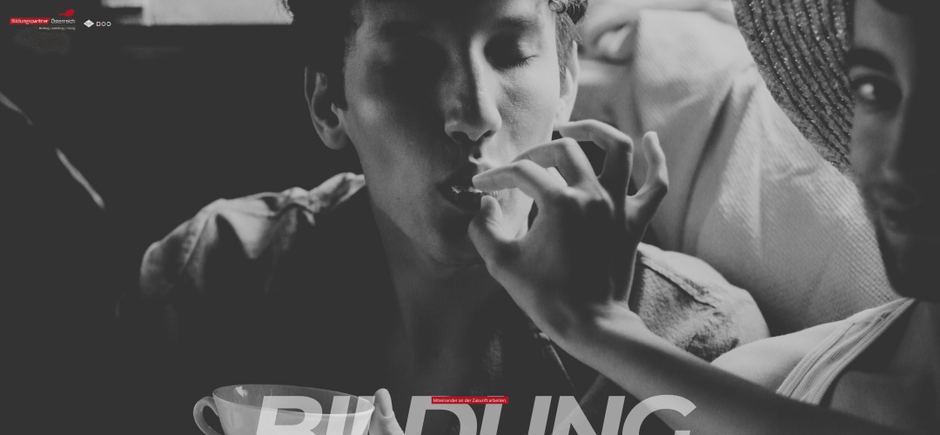
Lustig muss es sein
Lösung oder fatale Verirrung
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
In der aktuellen Aus-, Fort- und Weiterbildungslandschaft, von schulischen Curricula bis hin zu Fortbildungsangeboten für Erwachsene, hat sich ein Leitmotiv etabliert: Lernen muss Spaß machen. Was auf den ersten Blick wie eine progressive und humane Forderung erscheint, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine problematische und unzulässige Verkürzung komplexer pädagogischer und psychologischer Zusammenhänge.
Die pauschale Gleichsetzung von effektivem Lernen mit Vergnügen und Spaß verkennt die Natur des Wissenserwerbs und schafft eine Erwartungshaltung, die eher geeignet ist, Demotivation und Oberflächlichkeit zu kultivieren. Insbesondere in der Jugend- und Erwachsenenbildung, wo es um den Erwerb tiefgreifender Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen geht, ist eine kritische Reflexion dieses Paradigmas unerlässlich.
In dieser Gedankenskizze eine Betrachtung der historischen Ursprünge der Idee der Lernfreude, hin zur irreführenden Forderung nach Lernspaß. Was am Ende bleibt, ist ein realistisches Bildungsverständnis, das auf Relevanz, Herausforderung und dem Erleben von Selbstwirksamkeit aufbaut.
Die historischen Wurzeln: Lernfreude als Emanzipation vom autoritären Drill
Die Idee, dass Lernen ein freudvoller Akt sein kann, ist tief in der Reformpädagogik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts verwurzelt. Sie entstand als direkte Gegenbewegung zu den damals vorherrschenden „Paukschulen“, die von autoritärem Drill, sturem Auswendiglernen und einer passiven Rolle als Lernende geprägt waren. Persönlichkeiten wie Maria Montessori, John Dewey oder Georg Kerschensteiner strebten zu dieser Zeit danach, das lernende Subjekt in den Mittelpunkt zu rücken und dabei vor allem dessen natürliche Neugier zu fördern.
-
Maria Montessori (1870-1952) legte den Fokus auf die intrinsische Motivation. In ihrer Konzeption der "vorbereiteten Umgebung" sollten Lernende die Möglichkeit erhalten, sich
selbstständig und in ihrem eigenen Tempo mit Materialien auseinanderzusetzen. Die Freude am Lernen, die sie als "Polarisation der Aufmerksamkeit" beschrieb, resultierte aus tiefer
Konzentration und dem Stolz, eine Aufgabe eigenständig bewältigt zu haben. Es handelte sich um eine intellektuelle Befriedigung, nicht um oberflächliche Unterhaltung.
-
John Dewey (1859-1952), war ein Hauptvertreter des Pragmatismus, und er formulierte das Prinzip des „Learning by Doing“. Für ihn war Bildung untrennbar mit der Lebenswelt und den
praktischen Erfahrungen der Lernenden verbunden. Lernen sollte ein aktiver und problemlösender Prozess sein, in dem Wissen nicht als abstrakte Information konsumiert, sondern als Werkzeug zur
Bewältigung realer Herausforderungen angewendet wird. Die Sinnhaftigkeit und Relevanz dieses Prozesses erzeugten ein tiefes Gefühl der lustvollen Zufriedenheit.
- Auch Georg Kerschensteiner (1854-1932) betonte mit seinem Konzept der "Arbeitsschule" die Bedeutung der praktischen Tätigkeit. Bildung sollte in seinem Zugang auf die Entwicklung beruflicher und staatsbürgerlicher Tüchtigkeit ausgerichtet sein, was vor allem durch aktive und zielgerichtete Arbeit erreicht wird. Die Befriedigung entsteht hier aus dem sichtbaren Ergebnis der eigenen Anstrengung.
Das gemeinsame Ziel dieser reformpädagogischen Ansätze war also nicht, das Lernen zu einem Spiel zu machen, das bloß Spaß macht, sondern es als bedeutungsvoll, selbstbestimmt und kompetenzfördernd zu gestalten. Die daraus erwachsende Freude ist eine Konsequenz des gelungenen Lernprozesses und nicht dessen primäre Voraussetzung oder Methode.
Semantische Verschiebung: Von der Lernfreude zum Lernspaß
Die ursprüngliche, differenzierte Idee der Lernfreude erodierte im Laufe des 20. Jahrhunderts und wurde zunehmend zur simplen Forderung nach „Spaß“ abgekürzt. Diese Entwicklung wurde durch hedonistische gesamtgesellschaftliche Strömungen begünstigt, insbesondere durch den Aufstieg einer enormen Konsum- und Unterhaltungskultur, die auf ehestmögliche Bedürfnisbefriedigung und die Vermeidung jeglicher Anstrengung abzielt. Diese Logik der „Fun-Gesellschaft“ sickerte sukzessive auch (weitgehend unreflektiert) in den Jugend- und Erwachsenenbildungssektor ein. Die heute deutlich spürbaren Konsequenzen dieser Verschiebung sind gravierend:
-
Verzerrung des Lernbegriffs und Förderung von Oberflächlichkeit: Lernen ist in jedem Fall ein kognitiv anspruchsvoller und nicht einfacher Prozess. Er erfordert Konzentration, die
Auseinandersetzung mit komplexen, widersprüchlichen Informationen und die Bereitschaft, Routinen des Denkens zu verlassen. Diese Phasen sind in der Regel aufwendig, mühsam und frustrierend
und alles andere als lustig und unterhaltsam. Die Fixierung auf den Spaßfaktor trägt immer schon die Gefahr in sich, dass anspruchsvolle Inhalte vermieden oder didaktisch so stark vereinfacht
werden müssen („Edutainment“), dass nur, wenn überhaupt, ein oberflächliches Verständnis entstehen kann. Das so notwendige Deep Learning, also das Verstehen von Prinzipien, Zusammenhängen und
Wechselwirkungen, das für nachhaltiges Lernen so wichtig ist, wird durch Surface Learning, das bloße Memorieren isolierter Fakten, um bspw. Prüfungen zu bestehen, ersetzt.
-
Untergrabung der intrinsischen Motivation: Die Versuche, Lerninhalte künstlich unterhaltsam zu verpacken, verschieben auch den Motivationsfokus. Gelernt wird nicht mehr um der Sache
bzw. des Inhalts willen (intrinsische Motivation), sondern wegen des äußeren Anreizes der spaßigen Methode (extrinsische Motivation). Fällt dieser Anreiz weg oder wird er bspw. als infantil
empfunden, ein relativ häufiges Problem in der Jugend- und Erwachsenenbildung, bricht die Motivation zusammen. Echte, nachhaltige Motivation speist sich jedoch aus dem Interesse am Inhalt
selbst und dem Wunsch, eine Fertigkeit bzw. Kompetenz zu erwerben.
- Erosion von Frustrationstoleranz und Resilienz: Ein zentrales Bildungsziel bei allen Lernangeboten ist die Entwicklung von Durchhaltevermögen („Grit“) und der Kompetenz, mit Schwierigkeiten, Rückschlägen und Misserfolgen konstruktiv umzugehen. Ein Bildungssystem, das suggeriert, Lernen sei ein müheloses, spaßiges Vergnügen, verhindert das Training dieser essenziellen überfachlichen Kompetenzen. Lernende entwickeln eine immer geringere Toleranz gegenüber Frustration und neigen in der Folge dazu, bei der ersten Hürde aufzugeben, anstatt passende Strategien zur Problemlösung zu entwickeln. Das Überwinden von „wünschenswerten Schwierigkeiten“ (desirable difficulties) ist jedoch ein psychologisch nachgewiesener wichtiger Schlüssel für nachhaltigen Lernerfolg. Gemeint sind Lernstrategien, welche die Lernprozesse kurzfristig verlangsamen und/oder sogar erschweren, um langfristig die Behaltensleistung und den Transfer des Gelernten zu verbessern.
Ein Paradigmenwechsel: Von Spaß zu Engagement und Wirksamkeit
Eine zukunftsorientierte Pädagogik für Jugendliche und Erwachsene muss sich wieder von der Fiktion des permanenten Lernspaßes und der Unterhaltung lösen und stattdessen auf tiefere und nachhaltigere Motiv- und Motivationsquellen setzen. Die Motivationspsychologie, insbesondere die Selbstbestimmungstheorie (SDT) von Edward Deci und Richard Ryan (Recherche dazu lohnt sich), liefert dafür bspw. ein belastbares theoretisches Fundament. In ihrem Konzept wird die Lernlust und intrinsische Motivation durch die Befriedigung vor allem von drei psychologischen Grundmotiven bzw. -bedürfnissen genährt:
-
Kompetenzerleben: Das Gefühl, wirksam zu sein und Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Dieses Erleben ist das Resultat von Anstrengung und der erfolgreichen Anwendung von
Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.
-
Autonomie: Die Möglichkeit, innerhalb eines klar definierten Rahmens eigene Entscheidungen treffen, Lernwege mitzugestalten und Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen zu
können.
- Soziale Eingebundenheit: Das Gefühl der Zugehörigkeit und des konstruktiven Austauschs in Lerngemeinschaften (dazu gehören auch die Lehrenden), in der Frau, Mann und Divers sich unterstützt und respektiert fühlt.
Für die Bildungspraxis bedeutet das, Lernumgebungen und Lernformate zu schaffen und zur Verfügung zu stellen, die nicht primär unterhalten, sondern Neugier und Engagement fördern. An die Stelle des "Spaßes" treten weitaus wirkungsvollere Konzepte:
-
Faszination: Die Begeisterung, die aus der Tiefe und Komplexität eines Themas selbst entsteht. Gute Lehre weckt diese Faszination, anstatt sie mit oberflächlichen Gimmicks zu
überdecken.
-
Relevanz: Die klare und nachvollziehbare Verknüpfung von Lerninhalten mit der Lebens- und Arbeitswelt der Teilnehmenden. Erwachsene lernen bekannterweise am effektivsten, wenn sie den
unmittelbaren Nutzen des Gelernten für ihre Ziele erkennen.
- Herausforderung: Das Stellen von anspruchsvollen, aber erreichbaren Aufgaben (siehe z. B. Vygotskys „Zone der proximalen Entwicklung“; das ist die Zone, in der Lernende noch nicht allein Aufgaben lösen können, aber mit Unterstützung, Anleitung und/oder Zusammenarbeit mit kompetenteren Personen, z. B. Lehrenden, Mentorinnen und Mentoren oder erfahrener Lernpartnerinnen und Lernpartner, bewältigen können). Csikszentmihalyis „Flow-Kanal“ wäre ein drittes Wirkelement. Gemeint sind die Momente beim Lernen, in denen die Lernenden an ihre Grenzen gehen und zu Höchstleistungen auflaufen, um etwas für sich selbst Bedeutendes zu erreichen. D.h., die Bewältigung einer echten Herausforderung erzeugt einen weitaus größeren und nachhaltigeren Motivationsschub als das Absolvieren einer spielerischen Aufgabe oder Übung.
Methoden wie problembasiertes Lernen, Projektarbeit, Fallstudien oder forschendes Lernen sind besonders geeignet, um diese Prinzipien umzusetzen. Sie sind anspruchsvoll, fördern Autonomie und Kollaboration und führen gleichzeitig zu einem tiefen Gefühl der Selbstwirksamkeit, der Kompetenz und vor allem des Stolzes auf die eigene Leistung.
Fazit
Am Ende kann festgehalten werden, dass die Reise von der reformpädagogischen Idee der Lernfreude hin zum Diktat des Lernspaßes eine Geschichte der Vereinfachung ist. Während das ursprüngliche Anliegen, Lernen humaner, sinnvoller und selbstbestimmter zu gestalten, von ungebrochener Relevanz ist, erweist sich die Forderung nach permanentem Spaß als fataler Irrweg. Effektive Bildung für Jugendliche und Erwachsene zeichnet sich nicht durch die Abwesenheit von Anstrengung aus, sondern durch die Schaffung von Rahmenbedingungen, in denen Anstrengung als sinnhaft und lohnend wahrgenommen und empfunden wird.
Das Ziel darf nicht sein, Lernende zu unterhalten, sondern sie zu befähigen, Faszination für Inhalte zu entwickeln, die Relevanz für ihr Leben zu erkennen und aus der erfolgreichen Bewältigung von Herausforderungen eine tiefe und dauerhafte intellektuelle Befriedigung zu ziehen. Das ist, was mit lustvollem Spaß gemeint ist!
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Bei der Finalisierung des Beitrags haben die Autoren und Autorinnen ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro und Microsoft Word mit Copilot verwendet, um die sprachliche Formulierung zu prüfen und zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den Autor: innen.
