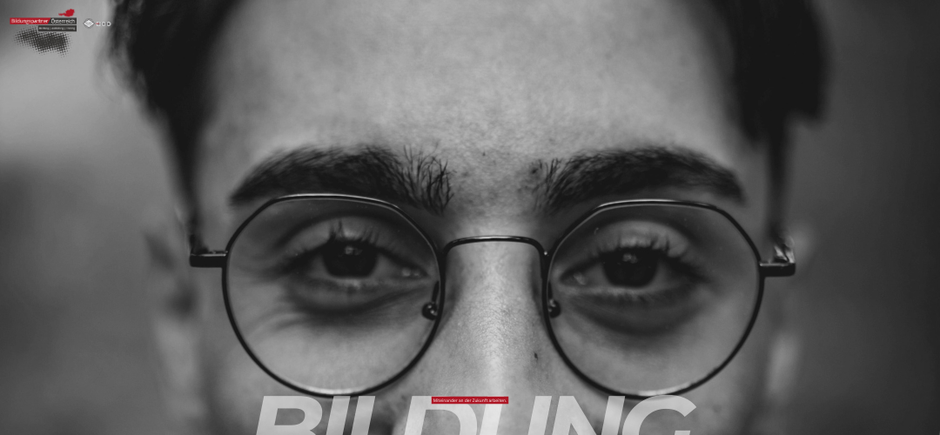
Der Exodus aus dem System Arbeit
Selbstständigkeit in der Erwachsenenbildung
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
In der Arbeitswelt ist aktuell ein signifikanter Trend zu beobachten: Immer mehr Fach- und Führungskräfte kehren etablierten Unternehmensstrukturen den Rücken, um sich im weiten Feld der Jugend- und Erwachsenenbildung teil- oder gänzlich selbstständig zu machen. Als Coaches, Trainerinnen und Trainer, Beraterinnen oder Kursentwickler oder Keynote Speaker suchen sie nach einer Alternative zu den als starr und sinnentleert empfundenen Hierarchien des traditionellen Arbeitsmarktes.
Dieser Wandel ist mehr als eine Summe individueller Karriereentscheidungen; er ist ein soziokulturelles Phänomen, das Fragen über den Zustand der Arbeitssysteme und die Definition von beruflichem Erfolg aufwirft. Eine Betrachtung aus bildungswissenschaftlicher, psychologischer und soziologischer Perspektive zeigt ein komplexes Bild aus legitimer Sinnsuche, strukturellen Defiziten und problematischen neuen Realitäten.
Die Treiber des Wandels: Zwischen Systemfrust und Sinnsuche
Die Motivation für den Wechsel in die Selbstständigkeit im Bildungsbereich speist sich aus zwei Hauptquellen: starken Push-Faktoren, die Menschen aus ihren bisherigen Positionen verdrängen, und attraktiven Pull-Faktoren, die der Bildungssektor (getrieben von den Aktivitäten in den sozialen Medien) in Aussicht stellt und verspricht.
- Psychologisch betrachtet sind die Push-Faktoren in der erlebten Dysfunktionalität traditioneller Arbeitsumgebungen verwurzelt. Ein hohes Maß an Fremdbestimmung, starre 9-to-5-Strukturen, Mikromanagement und eine als gering empfundene Wertschätzung führen bei vielen zu chronischem Stress, Bore-out oder Burnout. Das Gefühl, lediglich ein austauschbares Rädchen in einem anonymen Getriebe zu sein, erzeugt eine Entfremdung von der eigenen Tätigkeit. Die Arbeit wird nicht mehr als produktiver Teil des Lebens, sondern als Belastung wahrgenommen, der es zu entkommen gilt.
- Soziologisch wird dieser individuelle Leidensdruck durch einen Wertewandel in der Gesellschaft verstärkt. Während frühere Generationen beruflichen Erfolg primär über Stabilität, Gehalt und linearen Aufstieg definierten, rücken heute Aspekte wie Flexibilität, Autonomie, Work-Life-Integration und vor allem Sinnhaftigkeit in den Vordergrund. Die immer noch starren Strukturen vieler Unternehmen können diese neuen Bedürfnisse kaum befriedigen, was eine wachsende Dissonanz zwischen den Erwartungen der Arbeitnehmenden und der Realität des Arbeitsalltags erzeugt.
- Gleichzeitig übt der Sektor der Jugend- und Erwachsenenbildung eine enorme Anziehungskraft aus. Aus bildungswissenschaftlicher Sicht sind die Eintrittsbarrieren niedrig. Anders als in formalen Bildungssystemen sind keine staatlich regulierten Abschlüsse erforderlich, um als Coach oder Trainer bzw. Trainerin tätig zu werden. Die Digitalisierung und die Demokratisierung des Wissens durch Online-Plattformen, soziale Medien und Webinare ermöglichen es Einzelpersonen, mit relativ geringem Kapitaleinsatz eine eigene Marke und Reichweite aufzubauen. Zudem besteht auch ein realer Marktbedarf: Die schnelle Transformation der Arbeitswelt verlangt nach Kompetenzen, Resilienz, digitale Fitness, agile Methoden, emotionale Intelligenz, die formale Bildungseinrichtungen nur langsam in ihre Curricula integrieren. Diese Lücke füllen flexibel agierende Solo-Selbstständige, die aus eigener Erfahrung praxisnahe Lösungen anbieten.
Auf psychologischer Ebene bedient der Schritt in die Selbstständigkeit das menschliche Grundbedürfnis nach Autonomie, Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung. Die Vorstellung, die eigene Arbeitszeit, die Inhalte, den Arbeitsort und letztlich den eigenen Erfolg vollständig selbst zu gestalten, wirkt als starker Gegenspieler zur erlebten Fremdbestimmung. Dazu kommt der Faktor der Sinnstiftung: Die direkte Arbeit mit Menschen und die sichtbare Förderung ihrer Entwicklung verspricht eine unmittelbare Befriedigung, die in vielen klassischen Jobs fehlt.
Die Entzauberung des Traums: Eine kritische Betrachtung
Trotz dieser nachvollziehbaren Motive muss der Trend kritisch hinterfragt werden. Hinter der glänzenden Fassade der Selbstverwirklichung verbergen sich erhebliche Risiken und systemische Probleme, die häufig übersehen werden.
- Aus bildungswissenschaftlicher Perspektive ist die Dequalifizierung des Sektors besorgniserregend. Die niedrigen Eintrittsbarrieren führen zu einem unregulierten Markt, auf dem die Qualität der Angebote stark variiert. Pädagogisch-didaktische Expertise wird durch reines Erfahrungswissen und selbst gemixten Theoriewelten in Kombination mit geschicktem Marketing ersetzt. Das öffnet der Scharlatanerie jeder Form Tür und Tor und macht es für Konsumentinnen und Konsumenten schwierig bis nahezu unmöglich, seriöse von unseriösen Anbietenden zu unterscheiden. Bildung wird zur Ware degradiert, deren primäres Ziel nicht der nachhaltige Lernerfolg, sondern der Verkauf von Folgeprodukten in einem ausgeklügelten Sales Funnel ist.
- Die psychologische Kritik setzt bei der Motivation der Akteurinnen und Akteure selbst an. Viele folgen dem Narrativ des bzw. der "verletzten Heilers respektive Heilerin": Sie verarbeiten eigene persönliche und berufliche Krisen und die daraus erwachsenen Denk-, Meinungs-, Glaubens-, und Erklär-Welten, indem sie andere beraten, unterweisen, schulen und trainieren, ohne ihre eigenen Themen professionell reflektiert und bearbeitet zu haben. Das birgt die Gefahr, dass ungelöste persönliche Konflikte auf die Kundschaften projiziert werden. Die propagierte Autonomie entpuppt sich gar nicht selten als eine neue Form der Knechtschaft. Der Druck zur permanenten Sichtbarkeit in den sozialen Medien, zur Selbstvermarktung und zur Kundenakquise ersetzt den 9-to-5-Rhythmus durch eine 24/7-Verfügbarkeitskultur. Diese digitale Selbstausbeutung, getarnt als Leidenschaft, kann führt dann zu noch größerem Stress als der verlassene Angestelltenjob. Die zur Schau gestellte Authentizität wird zu einer performativen Notwendigkeit, bei der auch das eigene Leben strategisch zur Ware gemacht wird, um Interessierte anzulocken.
- Die schärfste Kritik kommt jedoch aus der soziologischen Analyse. Der Trend zur Solo-Selbstständigkeit im Bildungssektor ist ein Symptom einer neoliberalen Ideologie, die systemische Probleme individualisiert. Anstatt die krankmachenden Arbeitsstrukturen kollektiv zu hinterfragen und für bessere Bedingungen zu kämpfen, lautet die Botschaft: "Optimiere dich selbst!". Der Ausstieg der Einzelnen lindert deren persönliches Leid, stabilisiert aber gleichzeitig das dysfunktionale System, da der Druck zur Veränderung nachlässt. Dazu wird Prekarität (damit werden gesellschaftliche Gruppen bezeichnet, deren Lebens- und Arbeitsverhältnisse durch unsichere Beschäftigungsformen, fehlende soziale Absicherung und eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten geprägt sind) romantisiert und als unternehmerische Freiheit verklärt. Viele dieser Selbstständigen agieren ohne soziale Absicherung wie Kranken-, Pensions- oder Arbeitslosenversicherung. Schließlich reproduziert dieser Trend soziale Ungleichheit. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagen meist die, die über kulturelles, soziales und finanzielles Kapital verfügen. Ihre Angebote richten sich dann wiederum an eine zahlungskräftige Klientel, wodurch die Segregation auf dem Markt für Weiterbildung verstärkt wird.
Fazit: Symptom statt Lösung
Der Exodus aus traditionellen Arbeitssystemen in die Selbstständigkeit der Jugend- und Erwachsenenbildung ist eine verständliche und durchaus nachvollziehbare logische Reaktion auf die Defizite einer sich wandelnden Arbeitswelt. Er entspringt dem legitimen menschlichen Streben nach Sinn, Autonomie und Wertschätzung.
Jedoch ist es naiv, diesen Trend als universelle Lösung oder als erstrebenswertes Zukunftsmodell zu betrachten. Er ist vielmehr ein Symptom, das die tiefen Risse in den etablierten Karrieremodellen aufzeigt. Diese Entwicklung hin zum Ausstieg individualisiert systemische Probleme, normalisiert prekäre Arbeitsverhältnisse und zieht die Gefahr einer fortschreitenden De-Professionalisierung der Weiterbildungsbranche nach sich. Anstatt die grundlegenden Mängel der Arbeitswelt in Solidarität mit andern zu verändern, bietet sie in Wahrheit lediglich ein teures Pflaster für eine privilegierte Minderheiten und schaffen neue Formen von Druck und Unsicherheit. Die eigentliche Aufgabe besteht daher nicht darin, die Flucht aus dem System zu idealisieren, sondern das System selbst so zu reformieren, dass Arbeit für alle Menschen sinnstiftend und nachhaltig gestaltet ist.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich zu diesem Thema gerne auch in unseren Bildungsangeboten. Reden wir darüber! Unsere aktuellen Bildungsangebote:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Für die sprachliche Glättung und stilistische Vereinfachung dieses Beitrags wurden KI-basierte Tools (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Copilot) unterstützend eingesetzt. Alle inhaltlichen Aussagen und Schlussfolgerungen wurden von dem Autor ausgewählt, geprüft und verantwortet. Die KI hatte keine Rolle bei der inhaltlichen Generierung oder Bewertung der Forschungslage.
