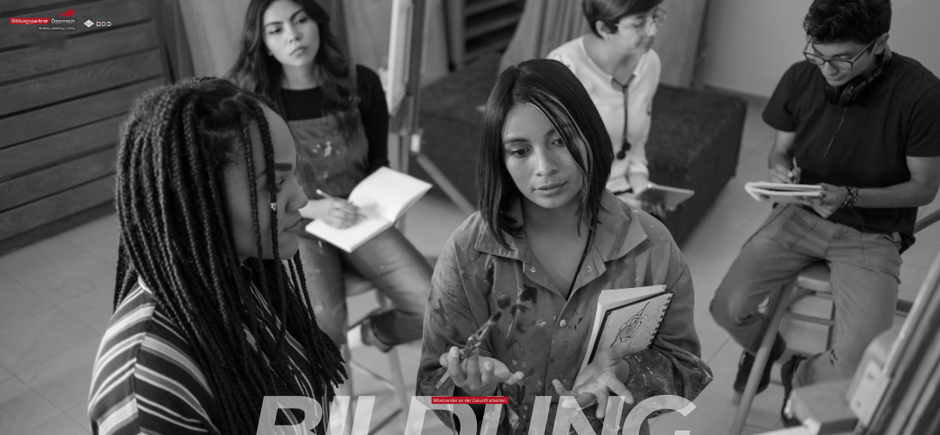
Vom Lehrplan zum Dialog
Abarbeiten von vorbereiteten Inhalten war gestern
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Frau, Mann und Divers stelle sich vor, man wählt sich in eine Online-Live-Sitzung ein oder trifft sich in einem Seminarraum. Aber anstelle einer klassischen Begrüßung und Einleitung mit nachfolgender frontaler PowerPoint-Präsentation erwartet die Teilnehmenden eine offene Runde, in der alle gleichberechtigt sind. Die moderierende Person begrüßt die Runde und lädt dann dazu ein, den Fahrplan für die gemeinsame Arbeit live auf einem digitalen Whiteboard bzw. Flipchart oder einer Pinnwand, basierend auf den konkreten Herausforderungen der Teilnehmenden, zu entwickeln.
Was in manchen Ohren wie eine Einladung zu einer netten Plauderei oder den Auftakt für Chaos klingen mag, ist in Wahrheit der Kern einer tiefgreifenden Transformation in der Jugend- und Erwachsenenbildung: die Abkehr vom starren Curriculum hin zu einem dynamischen und bedarfsorientierten Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden auf Augenhöhe.
Die Ära des Lehrplans: Ein Auslaufmodell mit Verdiensten
Um die Bedeutung dieses Wandels zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Der klassische Lehrplan hatte und hat in gewissen Bereichen seine Berechtigung. Er schafft Struktur, sorgt für eine standardisierte Wissensbasis und gewährleistet Vergleichbarkeit über verschiedene Lerngruppen und Institutionen hinweg. In einer Welt, in der Wissen über lange Zeiträume stabil war und klar definierte Qualifikationsprofile im Vordergrund gestanden haben, war dieses Top-down-Modell effizient. Lehrende vermittelten als Expertinnen und Experten einen zu großen Teilen festgelegten Kanon an Inhalten an eine Gruppe von Lernenden. Der Erfolg wurde am Ende durch Anwendung und/oder Prüfungen gemessen, die den Grad der Wissensaneignung bzw. die Fertigkeitsentwicklung bestätigten.
Doch die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Die Halbwertszeit von Wissen verkürzt sich rasant, Berufsbilder werden fluider und die Herausforderungen im Arbeitsalltag sind heute nur mehr sehr selten durch standardisierte Lehrbuchlösungen zu bewältigen. Die VUKA-Welt (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität) verlangt nicht nach Personen, die auswendig gelerntes Wissen reproduzieren können, sondern nach beweglichen, kritisch denkenden und problemlösungsorientierten Fachkräften.
Hier stößt das klassische lehrplangesteuerte Lernen deutlich an seine Grenzen:
-
Mangelnde Relevanz: Ein vor Monaten oder gar Jahren erstellter Lehrplan kann die tagesaktuellen, spezifischen Probleme der Teilnehmenden nicht adressieren.
-
Geringer Praxistransfer: Passiv konsumiertes Wissen wird als „träges Wissen“ abgespeichert. Der Transfer in den eigenen Berufsalltag gelingt nur schwer, weil der konkrete
Anwendungsfall in der Lernsituation fehlt.
-
Ignoranz gegenüber Vorkenntnissen: Ein starrer Plan behandelt alle Lernenden gleich und ignoriert die heterogenen Erfahrungen und Kompetenzen, die Jugendliche und Erwachsene bereits
mitbringen. Das führt zu Demotivation bei den einen und Unterforderung bei den anderen.
- Passive Lernhaltung: Das Abarbeiten von Inhalten fördert eine konsumierende Haltung, anstatt die Eigenverantwortung und aktive Mitgestaltung der Lernenden zu stärken.
Der Paradigmenwechsel: Das Fachgespräch als lernendes System
Der Gegenentwurf zum starren Lehrplan ist das bedarfsorientierte bzw. das Dialog-orientierte Fachgespräch. Das ist weit mehr als ein ungeplanter Plausch. Es handelt sich um einen strukturierten, moderierten und zielgerichteten Prozess, der die Lernenden ins Zentrum rückt. Der Ausgangspunkt dabei sind nicht vordefinierte Inhalte, sondern die realen Fragestellungen, Praxisfälle und Herausforderungen der Teilnehmenden.
Das Ziel verschiebt sich von der strukturierten Wissensvermittlung zur gemeinsamen Kompetenzentwicklung. In diesem Modell entsteht Wissen co-kreativ im Raum. Jede Person ist gleichzeitig Lernende und Lehrende, indem sie eigene Erfahrungen teilt, Lösungsansätze anderer reflektiert und gemeinsam neue Perspektiven entwickelt.
Die veränderte Rolle der Lehrenden: Vom Wissensmonopol zum Lernprozessbegleiter
Dieser Ansatz erfordert ein radikales Umdenken bei den Lehrenden. Ihre Rolle wandelt sich vom „Sage on the Stage“ zum „Guide on the Side“. Ihre Kernkompetenz liegt nicht mehr primär im lückenlosen Fachwissen (das ist ohnedies oft in der Gruppe bereits in hohem Maße vorhanden), sondern in der prozessualen und didaktischen Gestaltung des Lernraums.
Zu den wichtigsten Aufgaben einer solchen Lernbegleitung gehören:
-
Bedarfsermittlung: Zu Beginn einer Lehr-Lerneinheit die relevanten Themen und Fragen der Gruppe systematisch zu erheben (z.B. durch Kartenabfragen, digitale Umfragen oder eine offene
Diskussion).
-
Methodenkompetenz: Den passenden methodischen Rahmen für den Austausch zu schaffen. Formate wie BarCamps, World Cafés, Fishbowl-Diskussionen oder kollegiale Fallberatung ermöglichen
einen strukturierten und gleichzeitig offenen Dialog.
-
Moderation und Kuration: Das Gespräch zu lenken, sicherzustellen, dass alle zu Wort kommen, Diskussionen zu vertiefen und die erarbeiteten Erkenntnisse zu bündeln und zu sichern.
- Impulsgebung: Gezielt eigenes Fachwissen dann einzubringen, wenn es von der Gruppe benötigt wird, um eine Diskussion anzureichern oder eine Wissenslücke zu schließen.
Die Vorteile des bedarfsorientierten und dialogorientierten Fachgesprächs-Ansatzes
Der Wechsel zum dialogorientierten Lernen ist kein Selbstzweck. Er bringt konkrete, messbare Vorteile mit sich, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden.
-
Maximale Relevanz und Motivation: Da die Inhalte direkt aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmenden stammen, ist die Relevanz unmittelbar spürbar. Das führt zu einer signifikant höheren
intrinsischen Motivation und einem verbesserten Engagement.
-
Effektiver Praxistransfer: Lösungen und Strategien, die für ein reales Problem aus dem Kolleginnen und Kollegenkreis entwickelt werden, haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit,
auch tatsächlich umgesetzt zu werden. Der Lernprozess ist bereits der erste Schritt der Anwendung.
-
Förderung von Schlüsselkompetenzen: Im Fachgespräch werden Metakompetenzen wie kritisches Denken, Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Kollaboration ganz natürlich trainiert. Es geht
nicht nur darum, was man lernt, sondern wie man lernt.
-
Wertschätzung und Nutzung von Erfahrungswissen: Das vorhandene Wissen im Raum wird als Ressource anerkannt und aktiviert. Das stärkt das Selbstvertrauen der Teilnehmenden und fördert
eine Kultur des voneinander Lernens.
- Nachhaltige Vernetzung: Durch den intensiven Austausch lernen sich die Teilnehmenden als Fachexpertinnen und Fachexperten kennen und schätzen. Es entstehen nachhaltige Netzwerke, die weit über die Dauer der Aus-, Fort und Weiterbildung hinaus Bestand haben.
Die Umsetzung in der Praxis: Mut zur Lücke
Die Umstellung von lehrplan- auf dialogorientierte Formate erfordert Mut und Vertrauen: von der Organisation, den Lehrenden und den Lernenden. Anbietende und Organisationen müssen bereit sein, die Kontrolle über exakt definierte Lerninhalte ein Stück weit abzugeben und stattdessen auf die Kompetenz ihrer Mitarbeitenden und Lernbegleitenden zu vertrauen. Sie müssen die Sicherheit des vorbereiteten Skripts verlassen und sich auf die Dynamik des Prozesses einlassen. Und die Lernenden müssen die passive Konsumentinnen und Konsumentenrolle ablegen und aktiv Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess und den der Gruppe übernehmen.
Ein guter Startpunkt ist ein hybrides Modell: Ein grober Rahmen an übergeordneten Zielen oder Themenfeldern wird vorgegeben, die konkrete Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung erfolgt jedoch partizipativ mit der Gruppe. Es geht nicht darum, jegliche Struktur abzuschaffen, sondern eine Struktur zu schaffen, die atmen kann und sich an die Bedürfnisse der Menschen anpasst, für die sie gemacht ist.
In diesem Sinne ist die Abkehr vom starren Lehrplan mehr als nur eine didaktische Neuausrichtung. Es ist ein Bekenntnis zu einer Lernkultur, die den Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen in den Mittelpunkt stellt. Sie fördert eine Haltung des lebenslangen, neugierigen Entdeckens anstelle des bloßen Absolvierens von Kursen. Letztlich ist es die einzige logische Konsequenz für eine Bildung, die auf die Zukunft vorbereiten will, anstatt nur die Vergangenheit zu verwalten.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich zu diesem Thema gerne auch in unseren Bildungsangeboten. Reden wir darüber! Unsere aktuellen Bildungsangebote:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Für die sprachliche Glättung und stilistische Vereinfachung dieses Beitrags wurden KI-basierte Tools (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Copilot) unterstützend eingesetzt. Alle inhaltlichen Aussagen und Schlussfolgerungen wurden von Autor ausgewählt, geprüft und verantwortet. Die KI hatte keine Rolle bei der inhaltlichen Generierung oder Bewertung der Forschungslage.
