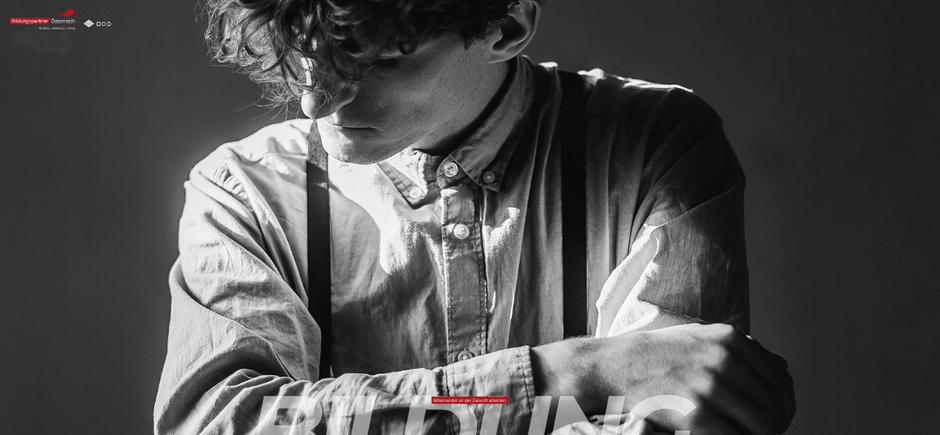
Der Resonanz-Kreis
Formatentwicklung in der Bildung
Autor: Manfred Hofferer, Yvonne Wendelin & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Bildung vollzieht sich über unterschiedlichste Bildungsformate. Dabei handelt es sich um konkrete, strukturierte Arten und Weisen, wie Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen vermittelt bzw. von den Lernenden angeeignet werden. Zu den Aufgaben der Bildungsarbeitenden gehört es, sich immer wieder auch auf die Suche zu begeben, um neue Wege und Zugangsweisen zu (er-)finden.
Das Konzept des Films „Kreis der Wahrheit“ von Robert Hofferer (2023) bietet eine hervorragende Grundlage für ein innovatives und neues Format in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Zentral geht es dabei darum, von der rein kognitiven Wissens- und Fertigkeitsvermittlung zu einer tieferen, emotionalen und erfahrungsbasierten persönlichen Auseinandersetzung mit komplexen Themen zu gelangen.
Das didaktische Konzept, das hinter dem Film „Kreis der Wahrheit“ steht, wurde von Arno Russeger bei der Premiere beim K3-Filmfestival (2023) als neues Doc-Genre eingestuft. Der Begriff beschreibt eine Grenzüberschreitung. Er löst die starren Grenzen zwischen dem Faktischen (Dokumentation), dem Ästhetischen (Kunst) und dem Narrativen (Spielfilm) auf.
Aus bildungswissenschaftlicher Sicht sind dieser Ansatz und Zugang besonders interessant, da sie komplexe historische und/oder gesellschaftliche Themen auf eine Weise zugänglich machen können, die sowohl intellektuell anregt als auch emotional berührt und auch der Zeit entspricht. Übersetzt man das Filmkonzept in ein Bildungsformat, dann lässt sich daraus eine spannende Methode ableiten.
Methoden-Design: Der Resonanz-Kreis
Ein Format zur transformativen Auseinandersetzung mit komplexen Themen
Das methodische Design dieses Formats zielt darauf ab, Lernprozesse in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen von der rein kognitiven Wissensvermittlung zu einer tieferen, emotionalen und erfahrungsbasierten Ebene zu führen. Statt über ein Thema zu sprechen, es zu lesen oder nur zu betrachten bzw. Fertigkeiten zu trainieren, ermöglicht es den Teilnehmenden, dieses durch einen zwischengeschalteten kreativen Prozess persönlich zu verarbeiten und aus neuen Perspektiven zu betrachten.
Das Format kann als ein dreiphasiger Begegnungs- Bearbeitungs- und Lernzyklus gedacht werden. Die drei Kernphasen des Formats sind:
Phase 1: Der Impuls (Das Ausgangsmaterial)
Der Ausgangspunkt des Annäherungs- und Lernprozesses ist ein authentisches und im besten Fall menschliches Dokument, das als emotionaler und thematisch-inhaltlicher Ausgangspunkt und Anker dient. Die Auswahl des Materials für diese erste Phase richtet sich nach dem jeweiligen Bildungsbereich und -thema sowie dem Ziel des Workshops.
Mögliche Ausgangsmaterialien je nach Bildungsbereich:
- Historisch-politische Bildung: Transkribierte Zeitzeugeninterviews, Feldpostbriefe, Auszüge aus Tagebüchern historischer Figuren, journalistische Reportagen aus Krisengebieten.
- Interkulturelles Training: Anonymisierte biografische Erzählungen von Personen mit Migrationserfahrung, Fallbeispiele von interkulturellen Konflikten am Arbeitsplatz.
- Persönlichkeitsentwicklung & Biographiearbeit: Literarische Texte über Lebenskrisen, anonymisierte Briefe, die persönliche Herausforderungen beschreiben, oder (in einem geschützten Rahmen) eine persönliche Geschichte eines Teilnehmenden.
- Organisationsentwicklung: Anonymisierte Protokolle konfliktreicher Teamsitzungen, eine Sammlung von Zitaten von Mitarbeitenden zu einem Veränderungsprozess.
Durchführung: Das Ausgangsmaterial wird der Gruppe durch die Leitenden vorgestellt, sei es durch Film, Vorlesen, als Audioaufnahme oder zur stillen Lektüre (zusätzlich können am Beginn spezielle Introspektionsaufgaben als Beobachtungsrichtlinien gegeben werden). Unmittelbar nach der Betrachtung bzw. der Aufnahme folgt eine kurze Phase der eigenen inneren Reflexion ohne eine analytische Diskussion, um den unmittelbaren Eindrücken Raum zu geben.
Phase 2: Die kreative Verarbeitung (Der Ausdrucks-Akt)
Diese Phase bildet das Herzstück des Formats. Die Teilnehmenden erhalten die Aufgabe, ihre unmittelbare Reaktion und Befindlichkeit auf den Impuls in eine selbstgewählte und frei kreative Form zu „übersetzen“. Sie werden aufgefordert, von passiven Rezipienten zu aktiven Gestaltenden zu werden.
Beispiele für das Methoden-Angebot zur Auswahl:
- Szenisches Schreiben/Spiel:
-
- „Schreiben Sie einen kurzen Monolog aus der Perspektive einer Person aus dem Text, Film, der Audioaufnahme etc.“
- „Stellen Sie eine zentrale Emotion aus der Geschichte bspw. als ‚lebende Skulptur‘ dar.“
- Kreatives Schreiben/Poesie:
-
- „Verfassen Sie ein kurzes Gedicht (z.B. ein Haiku oder Elfchen), das die Essenz des Gehörten einfängt.“
- „Schreiben Sie einen fiktiven Antwortbrief an die Person im Text.“
- Visuelle Gestaltung:
-
- Mit einfachen Materialien (Zeitschriften, farbiges Papier, Stifte, Stoffreste) eine Collage erstellen, die das zentrale Gefühl oder den Kernkonflikt visualisiert.
- Musik & Klang:
-
- Eine „Klanglandschaft“ zum Impuls mit einfachen Instrumenten (Rasseln, Trommeln) oder der eigenen Stimme gestalten.
Für die Durchführung arbeiten die Teilnehmenden einzeln, in Partnerarbeit oder in Kleingruppen. Entscheidend in dieser Phase ist die Haltung der Lehrenden in der Prozessbegleitung: Es geht nicht um die Erstellung eines Abbilds oder perfekten Kunstwerks, sondern um den Prozess des eigenen und hoch persönlichen Ausdrucks und der vom Leistungsdruck befreiten Auseinandersetzung mit dem Thema.
Phase 3: Integration im Plenum (Präsentation & Reflexion)
In dieser Zusammenfassenden und abschließenden Phase wird die Themenbeschäftigung physisch und metaphorisch geschlossen. Die Teilnehmenden kommen zusammen, um ihre geschaffenen Werke zu teilen und die daraus resultierenden Gedanken, Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse gemeinsam zu besprechen und zu reflektieren.
Durchführung in drei Schritten:
- Präsentation: Jede Person, jedes Paar oder jede Kleingruppe präsentiert ihr Werk im Plenum (liest den Text vor, zeigt die Collage, führt die Szene auf). Der Fokus der rezipierenden Teilnehmenden liegt auf aufmerksamem Wahrnehmen statt auf Applaus oder Bewertung.
- Resonanz-Runde: Nach jeder Präsentation erhalten die betrachtenden/zuhörenden Teilnehmenden die Möglichkeit, kurz und wertfrei ihre unmittelbare Wahrnehmung, ihre Gedanken und Gefühle zu spiegeln (z. B. „Ich habe eine große Schwere gespürt.“ oder „Die Farben der Collage haben mich hoffnungsvoll gestimmt.“).
- Geleitete Reflexion: Die Workshopleitung moderiert ein gemeinsames Gespräch und eine abschließende Diskussion, die den Prozess und die gewonnenen Erkenntnisse auf eine Metaebene hebt.
Beispiele für Leitfragen für die Reflexion:
- Wie hat der kreative Prozess die Wahrnehmung des ursprünglichen Impulses verändert?
- Welche Aspekte des Themas sind durch die kreative Form stärker hervorgetreten, die beim reinen Sehen, Lesen oder Hören verborgen geblieben wären?
- Was lerne ich durch die Vielfalt der entstandenen Werke über die Vielschichtigkeit des Themas?
- Wie kann ich diese tiefere, emotionale Ebene des Verstehens in den Alltag oder die Arbeit übertragen und integrieren?
Zusammenfassung der Methode
Der „Resonanz-Kreis“ ist ein Bildungsformat, das über reine Faktenvermittlung und das Erarbeiten von Fertigkeiten hinausgeht. Es schafft einen Raum für Empathie, Mehrdeutigkeit, eigene und persönliche Auseinandersetzung. Die Teilnehmenden werden angeregt, begleitet und in die Lage versetzt, eine eigene, aktive Form des Wahrnehmens-, Verstehens und zum Ausdruck bringen zu entwickeln und komplexe Inhalte nachhaltig zu verankern, indem sie diese nicht nur kognitiv, sondern emotional, gestalterisch und im Dialog durchdringen.
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich zu diesem Thema gerne auch in unseren Bildungsangeboten. Reden wir darüber! Unsere aktuellen Bildungsangebote:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Für die sprachliche Glättung und stilistische Vereinfachung dieses Beitrags wurden KI-basierte Tools (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Copilot) unterstützend eingesetzt. Alle inhaltlichen Aussagen und Schlussfolgerungen wurden von Autor ausgewählt, geprüft und verantwortet. Die KI hatte keine Rolle bei der inhaltlichen Generierung oder Bewertung der Forschungslage.
