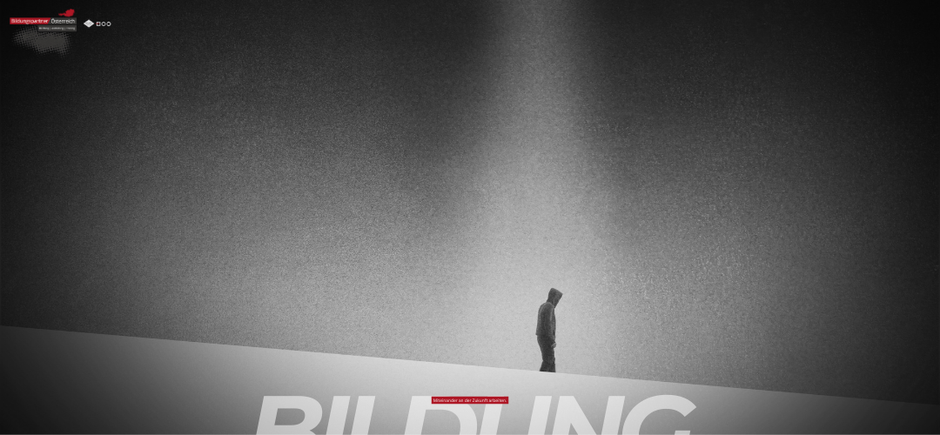
Die Leidenschaftsfalle
Zwischen Berufung und professionellem Beruf
Autor: Manfred Hofferer & Team Bildungspartner Österreich, © BPÖ 2025
Ein Funke kann ein Feuer entfachen, er kann für Licht und Wärme sorgen, ein Signal der Hoffnung sein oder den Motor für Großen Fortschritt zünden. Doch niemand würde auf die Idee kommen, ein Haus allein aus Funken zu bauen. Niemand würde erwarten, dass die bloße Existenz von Funken eine komplexe Maschine dauerhaft am Laufen hält.
In der modernen Arbeitswelt, insbesondere in den sozialen und bildenden Berufen, wird jedoch genau dies oft versucht. Die „Leidenschaft“ (der so gepriesene innere, brennende Funke) wird zur universalen Ressource erhoben, zur Währung, mit der alles bezahlt werden soll: unbezahlte Überstunden, prekäre Vertrags- und Arbeitsverhältnisse, mangelnde Anerkennung und stagnierende Honorare und Gehälter.
Und Achtung, eine Währung, die vorzugsweise auf Emotionen basiert, unterliegt einer gefährlichen Inflation (nicht nur in der Bildungslandschaft, in allen gesellschaftlichen Bereichen). Wenn Leidenschaft zur primären Entlohnung wird, entwertet sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Professionalität und die Gesundheit derjenigen, die in diesen wichtigen Sektoren tätig sind.
Die Falle: Wenn intrinsische Motivation zur Selbstausbeutung führt
Der Wert der intrinsischen Motivation ist in der psychologischen Forschung unbestritten. Menschen, die eine Tätigkeit um ihrer selbst willen ausüben, zeigen deutlich höhere Kreativität, mehr Ausdauer und vor allem ein tieferes Engagement. Bildungsberufe, allen voran die Erwachsenenbildung, ziehen naturgemäß Personen an, die eine solche intrinsische Motivation besitzen. Der Wunsch, Wissen zu vermitteln, Fertigkeiten aufzubauen und Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und gleichzeitig einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, ist ein starker Antrieb. Genau diese Stärke wird jedoch in vielen Kontexten zur Achillesferse.
Das Phänomen der „Passion Exploitation“ (Leidenschaftsausbeutung) beschreibt die Ausnutzung dieser intrinsischen Motivation. Es ist, so paradox es klingt, ein stiller Pakt, bei dem Arbeitgebende (oder das Bildungssystem) die emotionale Erfüllung der Arbeit als Teil der Vergütung betrachten. Die implizite Botschaft lautet: „Du liebst doch, was du tust, also brauchst du keine adäquate Bezahlung oder geregelte Arbeitszeiten.“ Das führt zu einer gefährlichen Normalisierung der Selbstausbeutung. Die leidenschaftlichen Jugend- und Erwachsenenbildenden, die am Wochenende unentgeltlich ein neues Seminarkonzept entwickeln, die Kursleiterin, die abends noch lange E-Mails von Teilnehmenden beantwortet, oder der Trainer, der für ein niedriges Honorar weite Reisen auf sich nimmt, tun dies oft aus einem Gefühl der Verpflichtung und des persönlichen Engagements heraus.
Psychologisch betrachtet erodieren dabei die fundamental wichtigen Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Die berufliche Identität verschmilzt mit der persönlichen, was die Möglichkeit zur Regeneration und psychischen Distanzierung massiv beeinträchtigt. Langfristig ist dieser Zustand nicht aufrechtzuerhalten. Diese ständige Überbeanspruchung und Überlastung und das Gefühl, mehr zu geben als zurückzubekommen (sowohl finanziell als auch in Form von Anerkennung und Ressourcen), münden unweigerlich in emotionaler Erschöpfung. Der Weg zum Burnout ist hier vorgezeichnet: Was als lodernde Leidenschaft begann, endet in einem Zustand von Zynismus, Depersonalisierung und dem Gefühl des völligen Ausgebrannt Seins. Die wertvollste Ressource der Lehrenden, ihre ursprüngliche Begeisterung, ist damit vernichtet.
Die pädagogische Deprofessionalisierung: Von Expertinnen und Experten zu engagierten Laien
Wenn die „Leidenschaft“ zur Hauptqualifikation und als Hauptantrieb erhoben wird, hat das verheerende Auswirkungen auf die Professionalität des gesamten Berufsstandes. Erwachsenenbildung ist eine hochkomplexe wissenschaftliche Disziplin. Sie erfordert fundierte Kenntnisse in Geschichte, Theorien, Didaktik, Methodik, Lernpsychologie, Gruppendynamik und dem jeweiligen Fachgebiet. Professionelle Erwachsenenbildende sind nicht bloß „Wissensvermittelnde“, sondern Lernarchitektinnen und -architekten, Moderatorinnen und Moderatoren, ein Coach und eine Diagnostikerin für Bildungsbedarfe. Diese Kompetenzen werden in anspruchsvollen Aus-, Fort- und Weiterbildungen erworben und müssen kontinuierlich aktualisiert und auf dem Stand gehalten werden.
Die Fokussierung auf Leidenschaft verschiebt diesen Diskurs von Kompetenz zu Emotion. Sie suggeriert, dass ein brennendes Herz für die Sache eine fehlende didaktische Ausbildung oder eine mangelhafte Vorbereitung kompensieren könnte. Das öffnet Tür und Tor für eine Deprofessionalisierung und Prekarisierung. Qualifikationen werden in diesem Kontext zweitrangig, Honorare und Gehälter sinken, da der Markt mit „leidenschaftlichen“ Anbietenden geflutet wird, die bereit sind, weit unter professionellen Standards zu arbeiten. Der Verweis auf die „Berufung“ wird zu einem Instrument, um Qualitätsstandards zu unterlaufen und Lohndumping zu rechtfertigen.
Für Lernende ist diese Entwicklung genauso fatal. Sie haben ein Anrecht auf hochqualitative Bildungsangebote, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und erprobten Methoden basieren. Leidenschaftliche, aber didaktisch ungeschulte Lehrende mögen kurzfristig inspirieren und anregen, doch nachhaltige Lernerfolge und die Entwicklung komplexer Kompetenzen erfordern professionelles Handwerk. Die Reduktion der Lehrtätigkeit auf ein bestimmtes Maß an Begeisterung ist daher nicht nur eine Missachtung der Lehrenden, sondern auch eine Täuschung der Lernenden. Eine professionelle pädagogische Beziehung basiert auf Empathie und Engagement, aber ebenso auf professioneller Distanz. Dieses Abstandhalten ermöglicht es dem Lehrenden, objektive Bewertungen vorzunehmen, schwierige Gruppenprozesse zu steuern und auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben. Eine überbordende, unreflektierte Leidenschaft löst diese notwendige Distanz regelmäßig auf und führt zu unprofessionellen Verstrickungen und falschen Fraternisierungen.
Das sozioökonomische Dilemma: Eine schlechte Währung in einem unterfinanzierten System
Die Problematik der „Leidenschaftswährung“ ist untrennbar mit der sozioökonomischen Realität des Bildungssektors verbunden. Insbesondere die Jugend- und Erwachsenenbildung ist in vielen Bereichen chronisch unterfinanziert. Öffentliche Gelder sind knapp, der Wettbewerb ist hoch und der Preisdruck enorm. In diesem Umfeld wird die Leidenschaft der Akteurinnen und Akteure zu einem systemrelevanten, aber unbezahlten Produktionsfaktor.
Lehrende in der Jugend- und Erwachsenenbildung arbeiten überdurchschnittlich oft als Freiberufler oder auf Basis befristeter Honorarverträge. Soziale Absicherung, bezahlter Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind für den größten Teil ein Fremdwort. Die Honorarsätze decken häufig kaum mehr als die reine Unterrichtszeit ab; die immense Arbeit für Vor- und Nachbereitung, Akquise, Verwaltung und eigene Weiterbildung bleibt unsichtbar und unvergütet. Dieses System funktioniert nur, weil es immer noch genügend Menschen gibt, die bereit sind, diese Bedingungen aus Leidenschaft für ihre Tätigkeit und ihre Ziele zu akzeptieren.
Was dabei aber übersehen wird, ist, dass damit Leidenschaft zu einem Mechanismus der Marktverzerrung wird. Sie subventioniert ein System, das ohne dieses freiwillige Engagement längst zusammengebrochen wäre. Wer auf eine angemessene Bezahlung und faire Vertragsbedingungen pocht, wird schnell als Bildungssöldnerin bzw. -söldner oder als „weniger engagiert“ angesprochen und dargestellt. Das erzeugt automatisch einen enormen Druck, bspw. die eigenen professionellen und finanziellen Ansprüche zurückzustellen, um nicht aus dem System ausgeschlossen zu werden. Der Verweis auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit wird zur moralischen Waffe gegen legitime Forderungen nach ökonomischer Sicherheit.
Plädoyer für eine neue Professionalität: Leidenschaft und Rahmenbedingungen im Einklang
Die Lösung kann auf keinem Fall darin bestehen, Leidenschaft aus dem Beruf zu verbannen. Sie ist und bleibt ein wertvoller Antrieb für Innovation und Qualität in der Bildung. Die Perspektive muss sich jedoch radikal ändern: Leidenschaft darf nicht länger die Kompensation für schlechte und unklare (Rahmen-) Bedingungen sein, sondern muss als Bonus zu einer soliden professionellen Grundlage hinzukommen.
Eine zukunftsfähige und nachhaltige Professionalität in der Jugend- und Erwachsenenbildung braucht ein Fundament aus zumindest drei Säulen:
-
Anerkennung von Qualifikationen: Die Einstellung und Beauftragung von Lehrenden müssen primär auf Basis nachweisbarer fachlicher, didaktischer und methodischer Kompetenzen
erfolgen.
-
Faire ökonomische Bedingungen: Dazu gehören transparente Verträge, Honorare, die den gesamten Arbeitsaufwand abbilden, soziale Absicherung und die Finanzierung von Aus-, Fort- und
Weiterbildung.
- Professionelle Strukturen: Institutionen müssen Ressourcen für Supervision, kollegialen Austausch und die psychische Entlastung ihrer Lehrenden bereitstellen. Eine Kultur, welche die Einhaltung von Arbeitszeiten und die Abgrenzung vom Beruf aktiv fördert, ist essenziell für die Gesunderhaltung.
Leidenschaft ist der Funke, der das Feuer entfacht. Damit es jedoch nachhaltig brennt (und nicht ausbrennt), braucht es einen gut gebauten Ofen aus professionellen Strukturen, ausreichend externen Brennstoffen in Form fairer Vergütung und regelmäßige Wartung durch Supervision und Weiterbildung. Nur wenn diese Bedingungen auseichend erfüllt sind, kann die Leidenschaft ihre positive Kraft entfalten, ohne die Lehrenden zu verzehren und die Professionalität des Berufsstandes auszuhöhlen
Wenn Interesse und Bedarf bestehen, unterstützen wir dich gerne. Reden wir darüber! Unsere Angebote zu diesem Themenbereich:
- Lehrlingsbildung
- Train the Trainer:in
- Soft Skill Trainer:in
- Outdoorpädagogik
- Bildungsbike-Trainer:in
- Ausbildung Bildungsbiken
HINWEIS: Für die sprachliche Glättung und stilistische Vereinfachung dieses Beitrags wurden KI-basierte Tools (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Copilot) unterstützend eingesetzt. Alle inhaltlichen Aussagen und Schlussfolgerungen wurden von dem Autor ausgewählt, geprüft und verantwortet. Die KI hatte keine Rolle bei der inhaltlichen Generierung oder Bewertung der Forschungslage.
